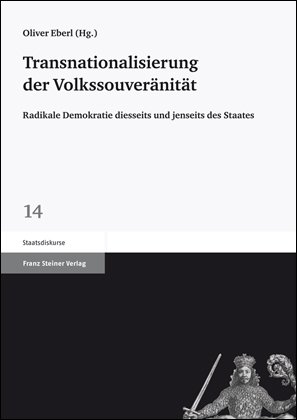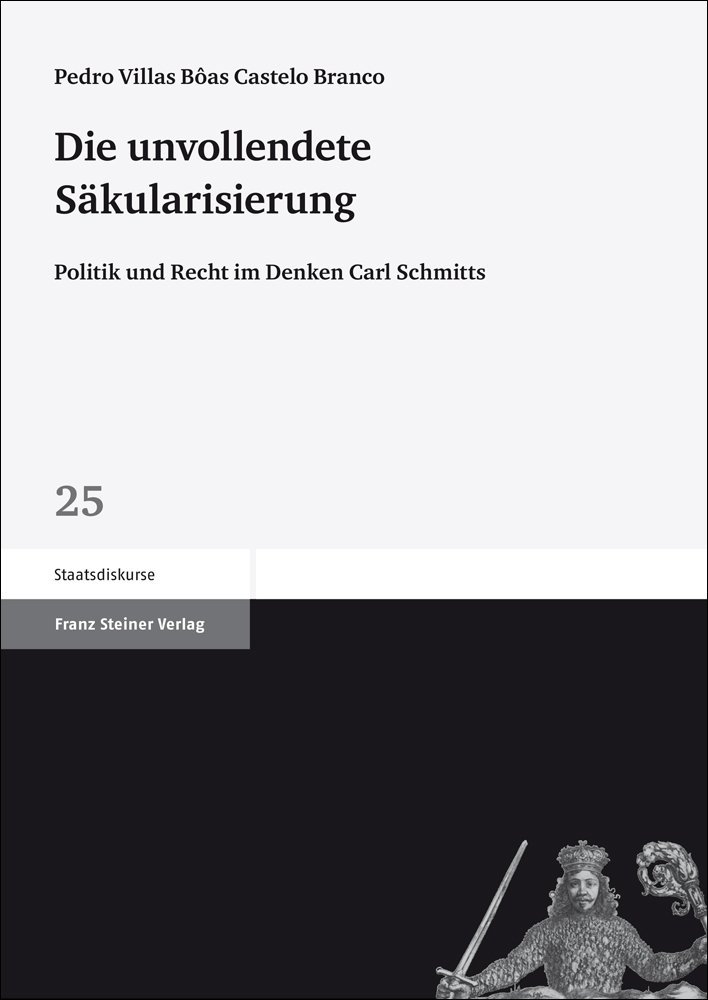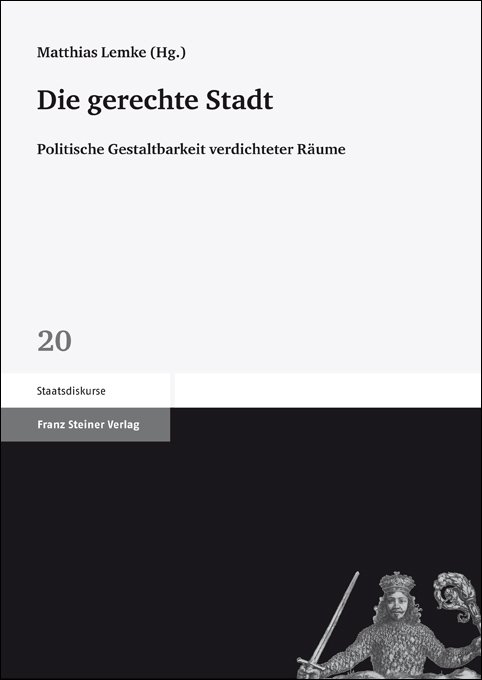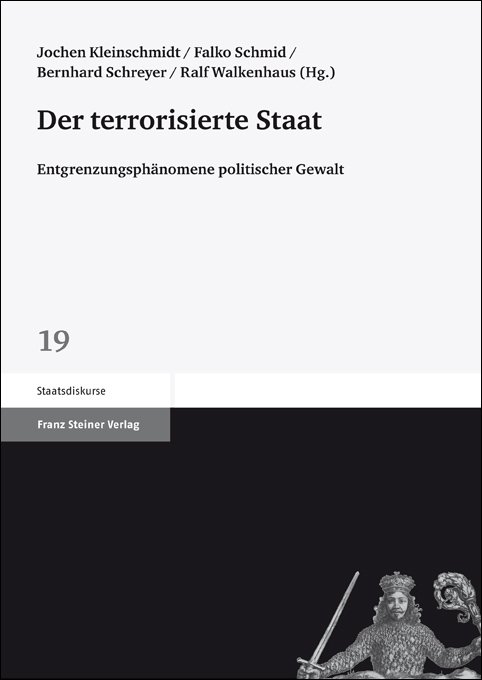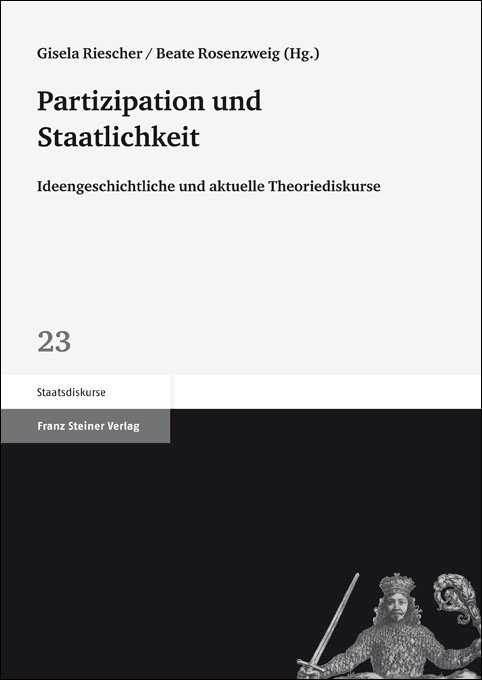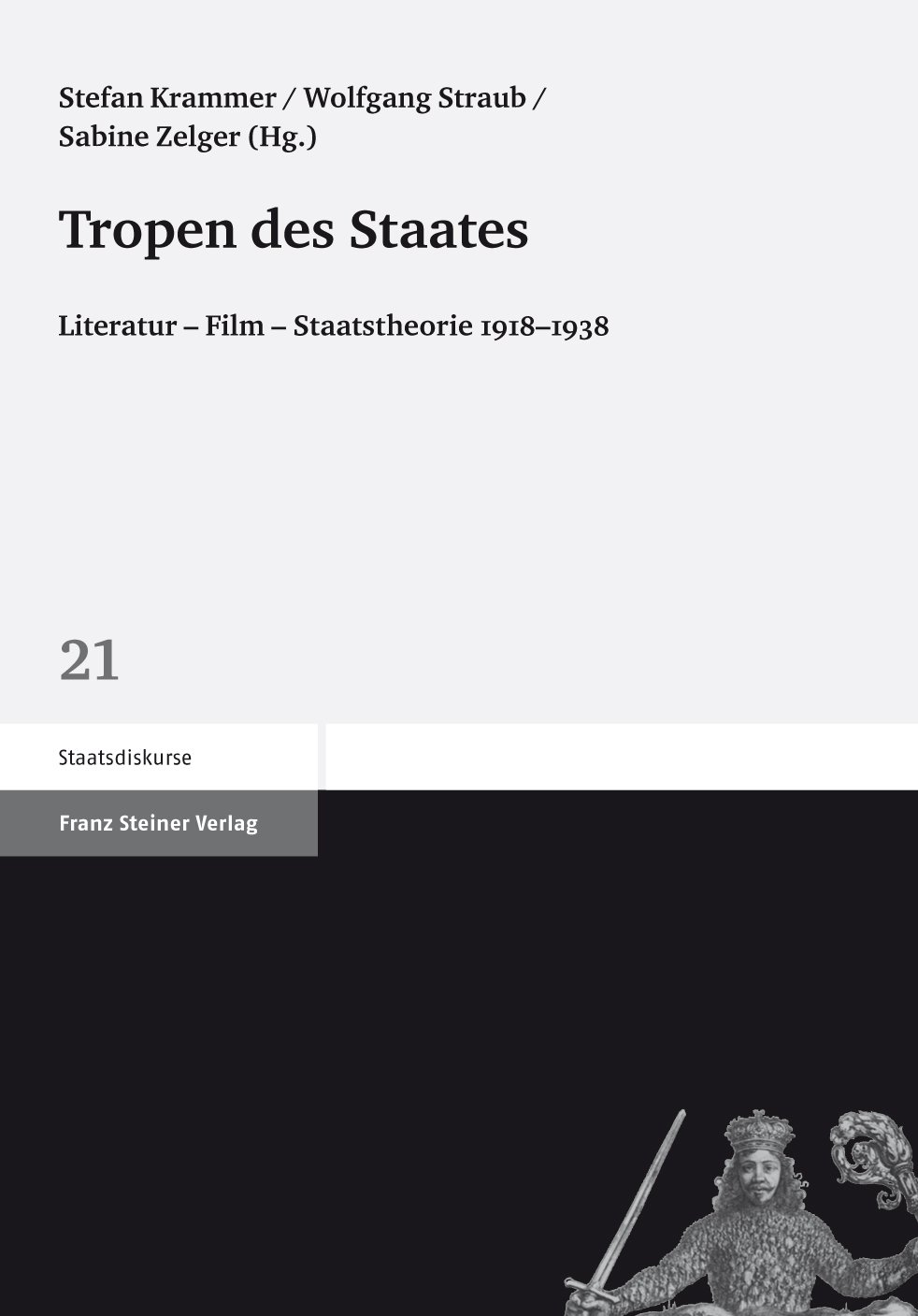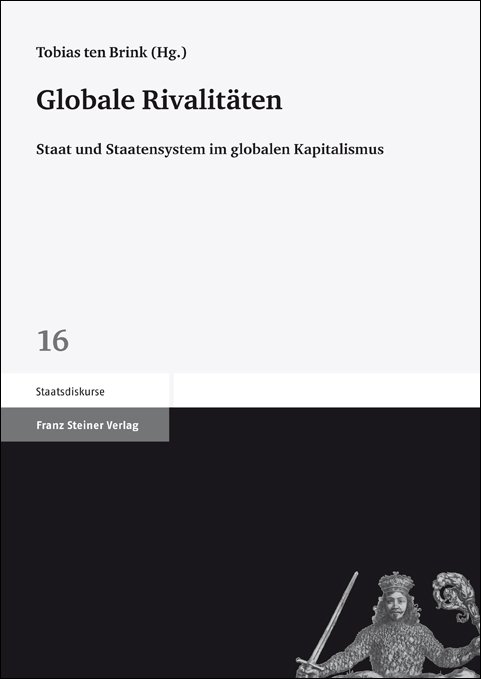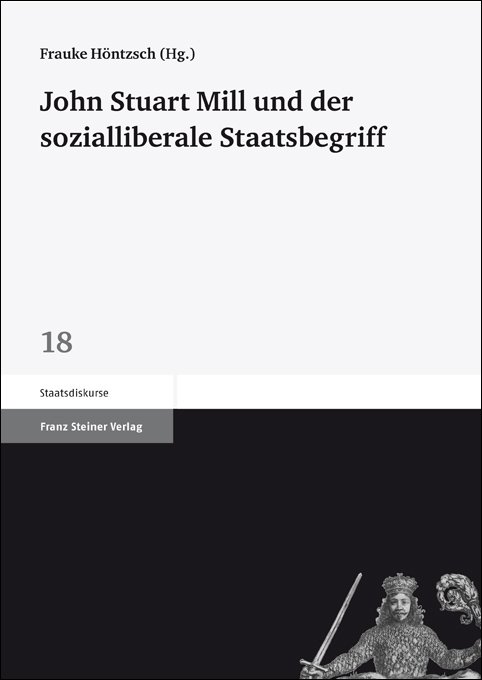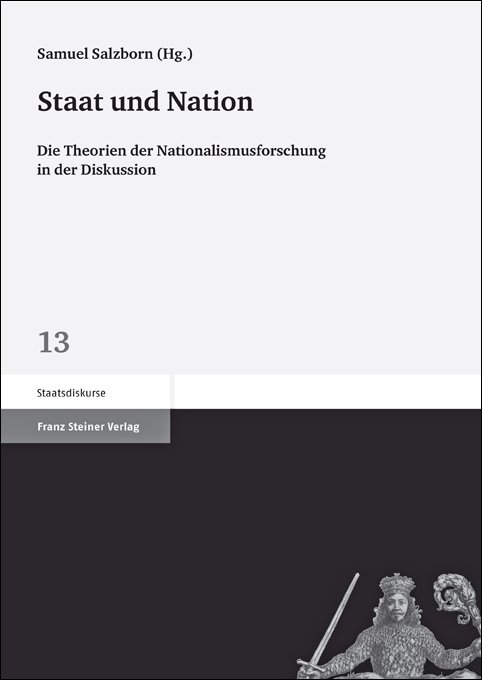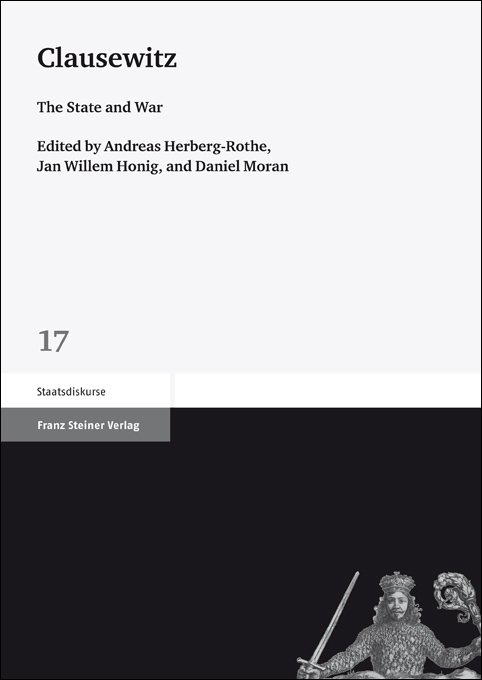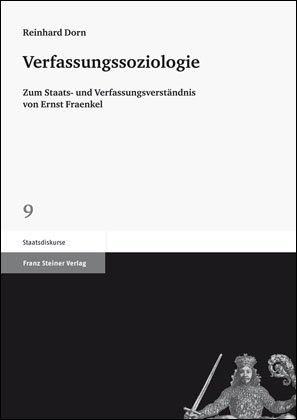Transnationalisierung der Volkssouveränität
Transnationalisierung der Volkssouveränität
Mehr als zweihundert Jahre nach der Französischen Revolution stellt sich die Frage, wie ihre zentrale staatstheoretische Errungenschaft, die Theorie der Volkssouveränität, den Herausforderungen der Globalisierung widerstehen oder zur Demokratisierung der internationalen Beziehungen beitragen kann. Volkssouveränität heißt, dass alle Macht zur Verfassung- und Gesetzgebung in den Händen des Volkes liegt. Gesetzgebung durch das Volk und Rechtsstaatlichkeit gehen in ihr eine konstitutive Verbindung ein.
Kann Volkssouveränität die globalen Grenzüberschreitungen der wirtschaftlichen und kommunikativen Systeme durch Transnationalisierung demokratisch nachvollziehen? Oder wird nicht vielmehr eine demokratische Kontrolle der Politik durch die globale Entgrenzung unmöglich gemacht? Wie stehen die Chancen radikaler Demokratie im 21. Jahrhundert diesseits und jenseits des Staates?
"Insgesamt ein glänzend gelungener Band, der mit seinen Beiträgen die Diskussion radikaler transnationaler Demokratietheorie an den Schnittstellen von Philosophie, Politikwissenschaften und Soziologie voranbringt."
Thore Prien, Neue Politische Literatur 57, 2012/3
| Reihe | Staatsdiskurse |
|---|---|
| Band | 14 |
| ISBN | 978-3-515-09830-4 |
| Medientyp | Buch - Kartoniert |
| Auflage | 1. |
| Copyrightjahr | 2011 |
| Verlag | Franz Steiner Verlag |
| Umfang | 354 Seiten |
| Format | 17,0 x 24,0 cm |
| Sprache | Deutsch |