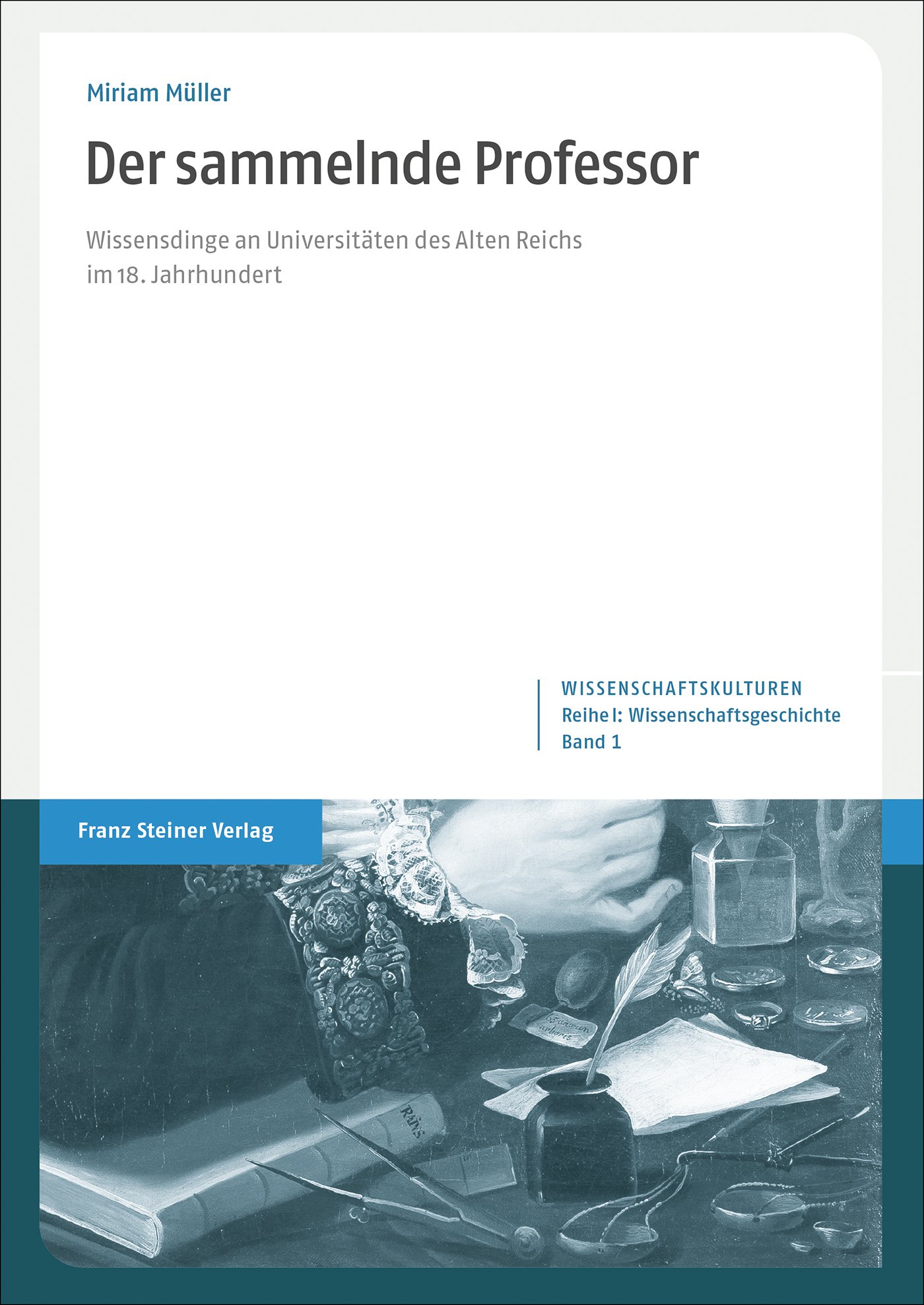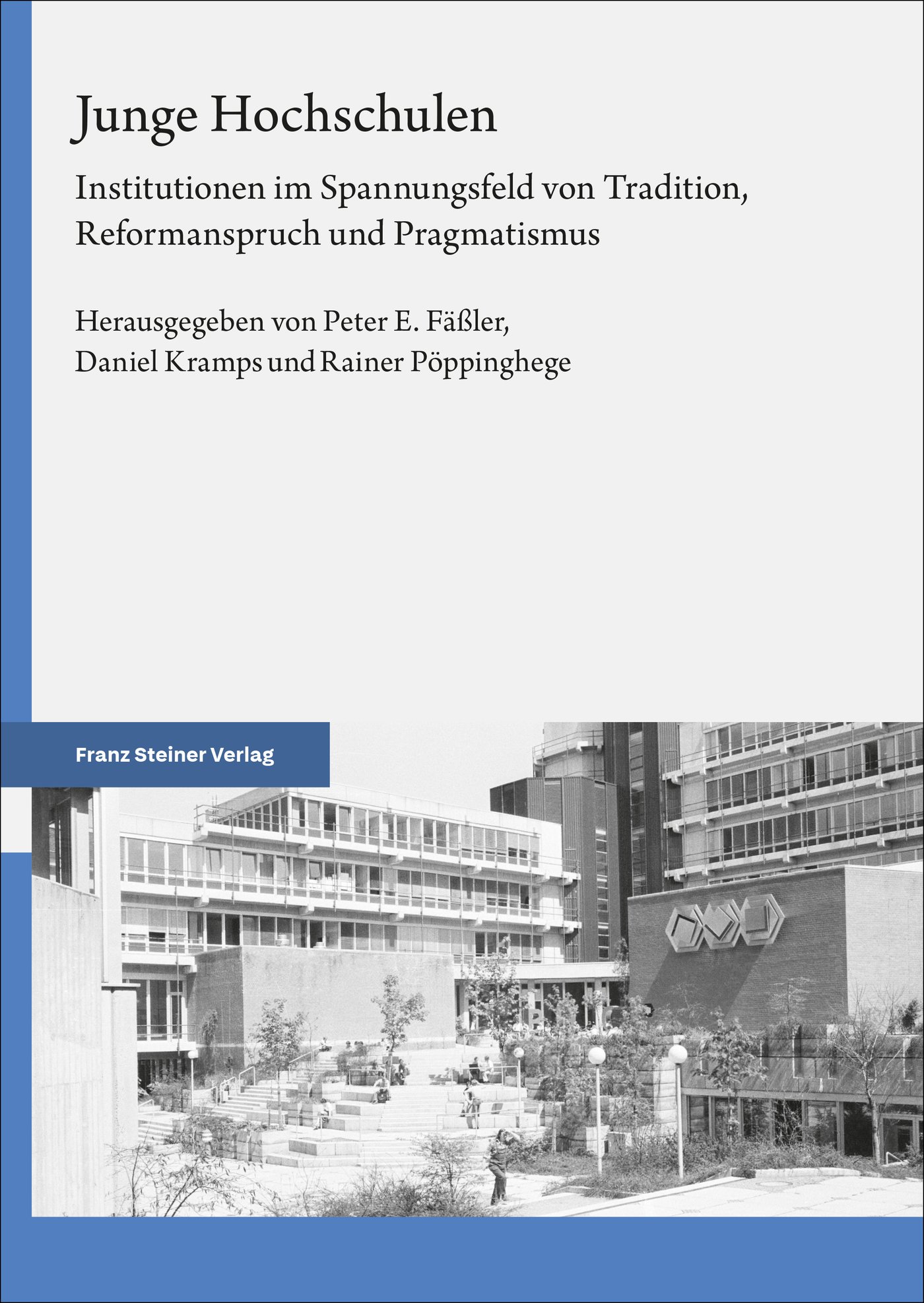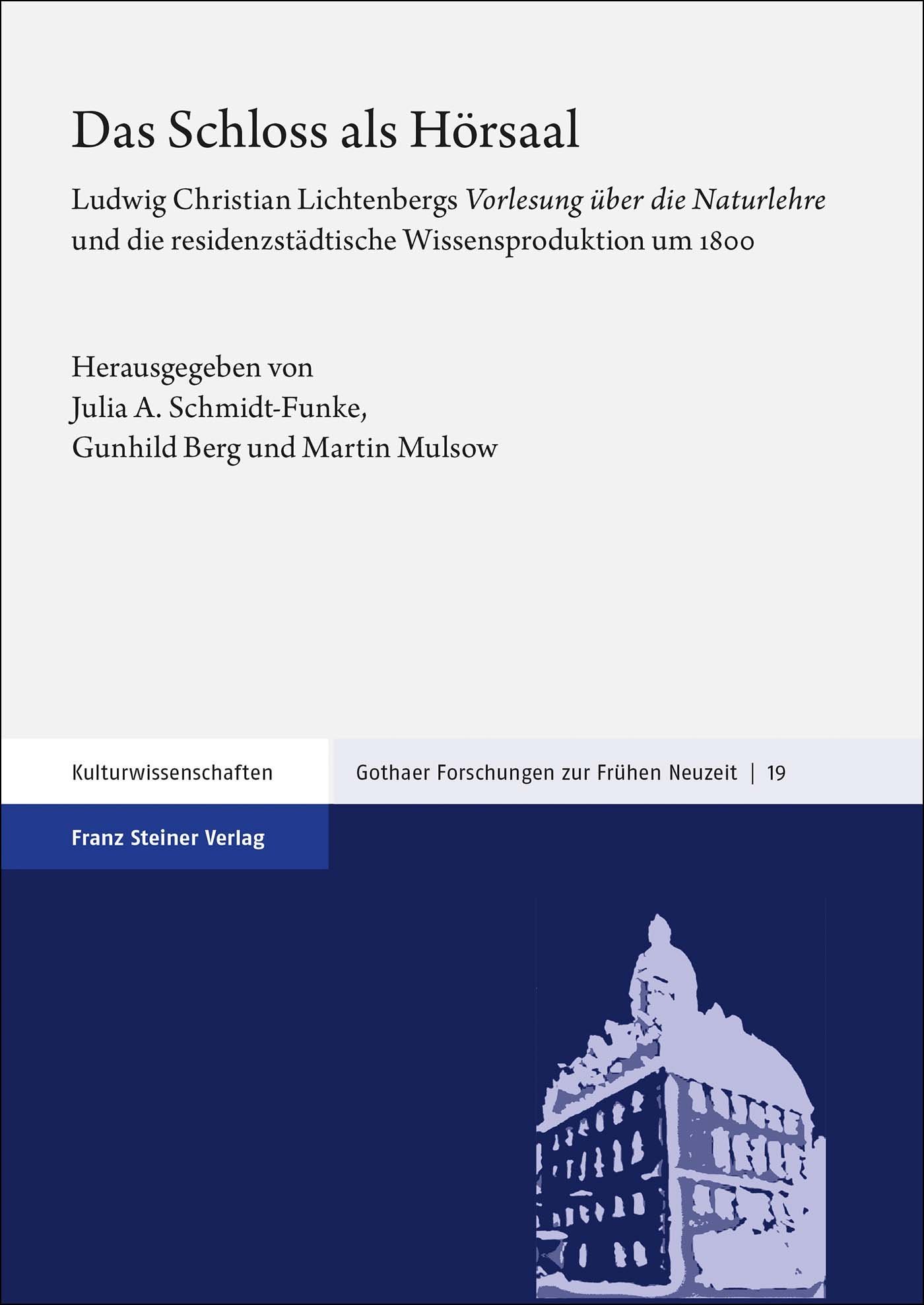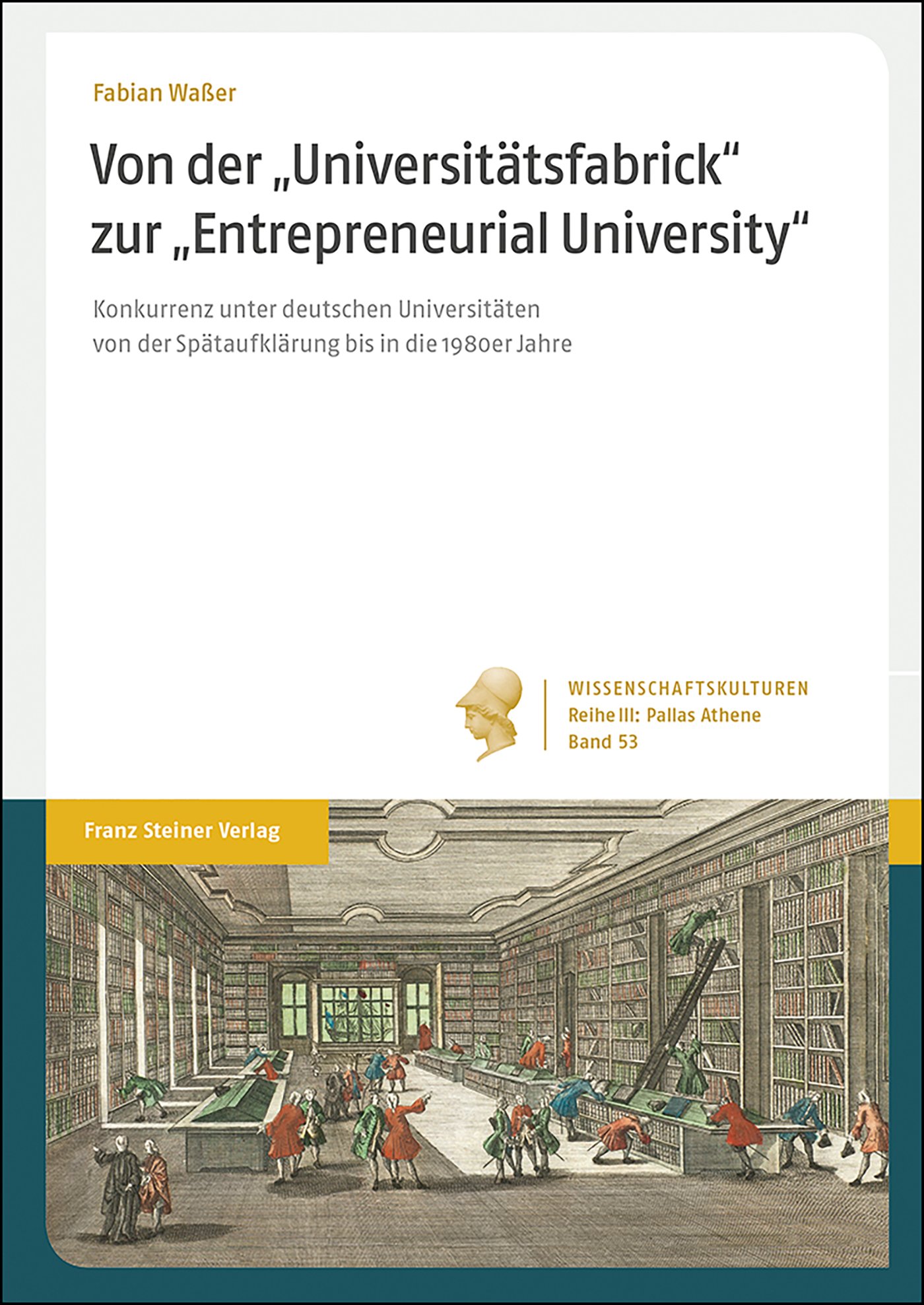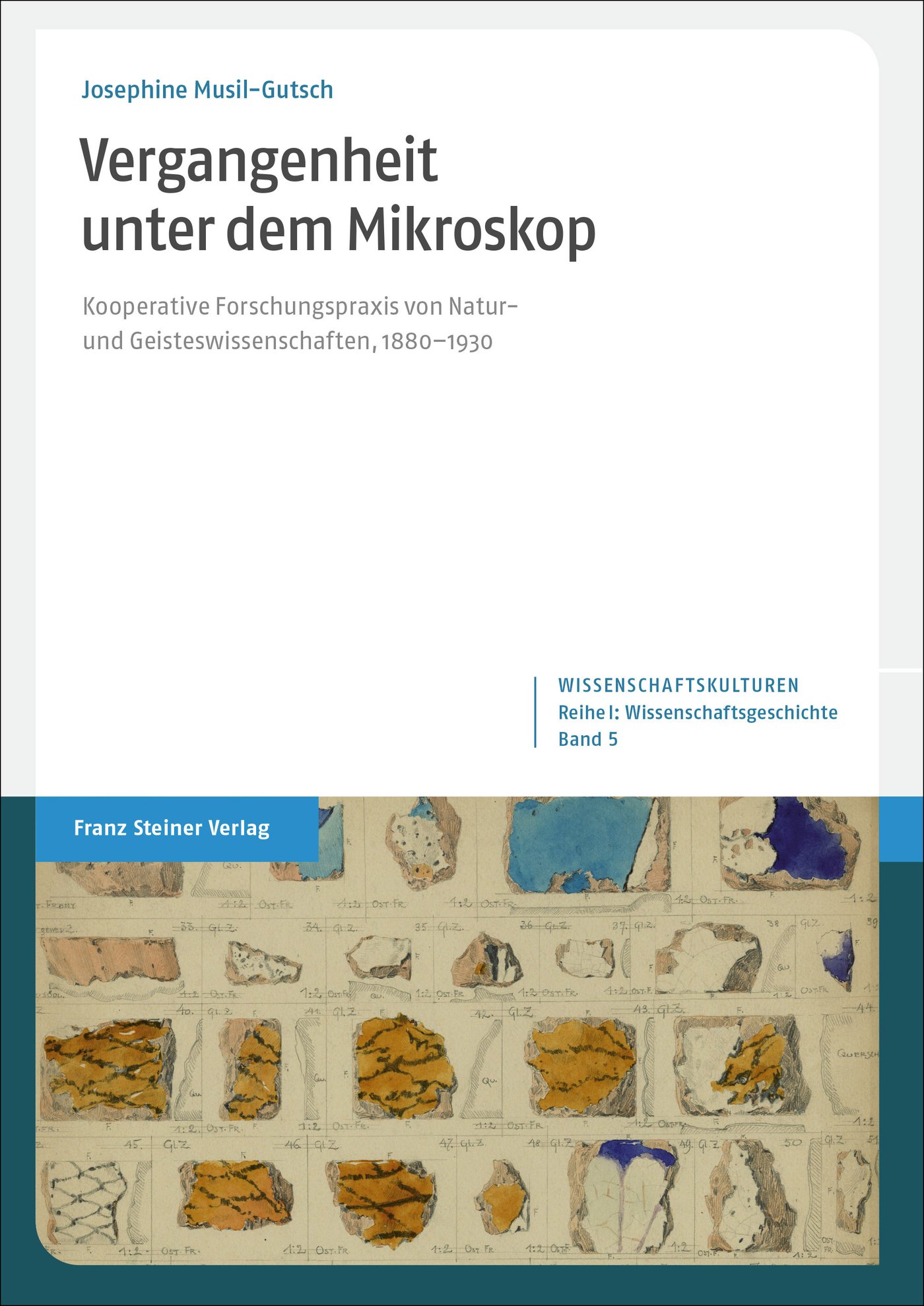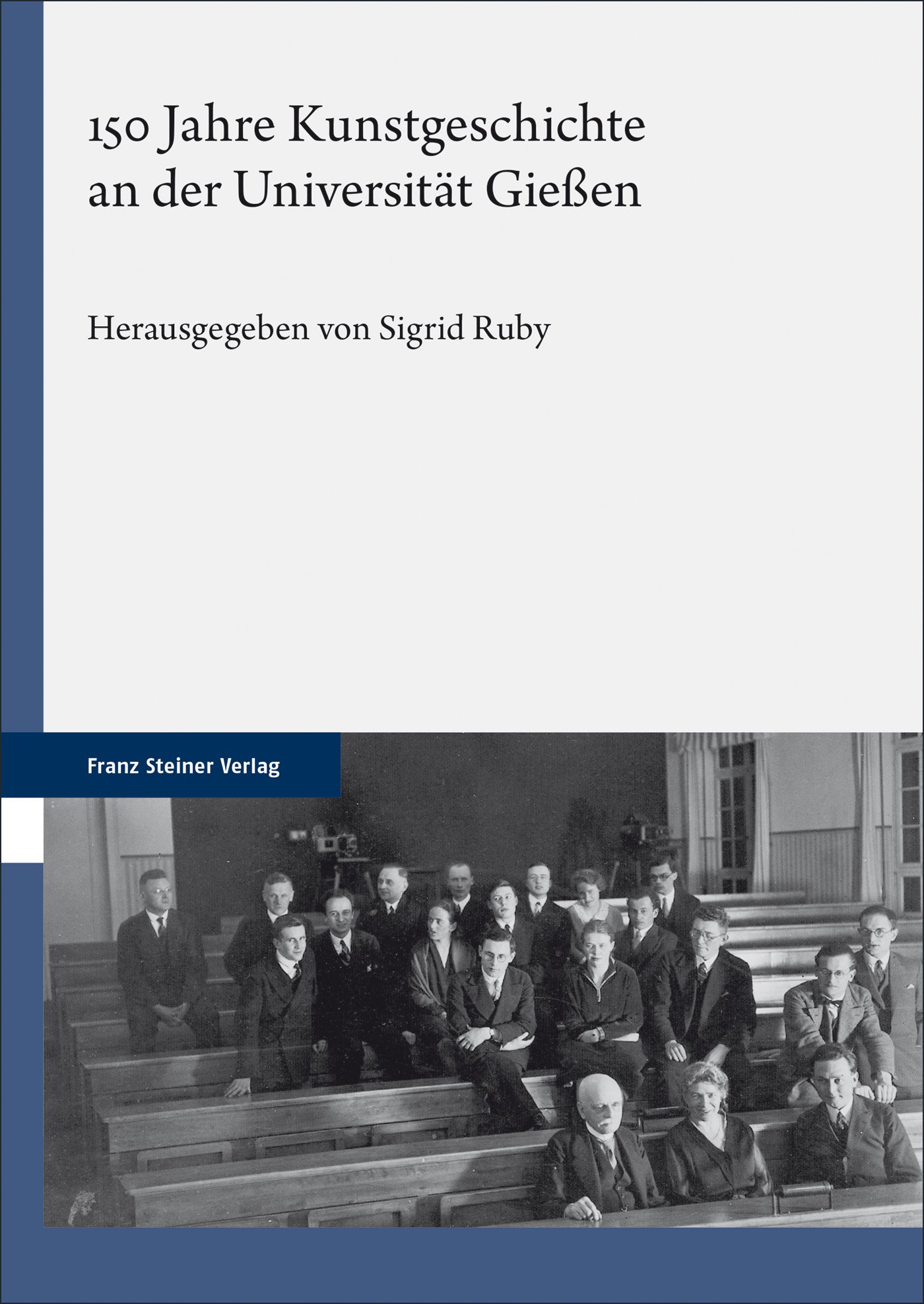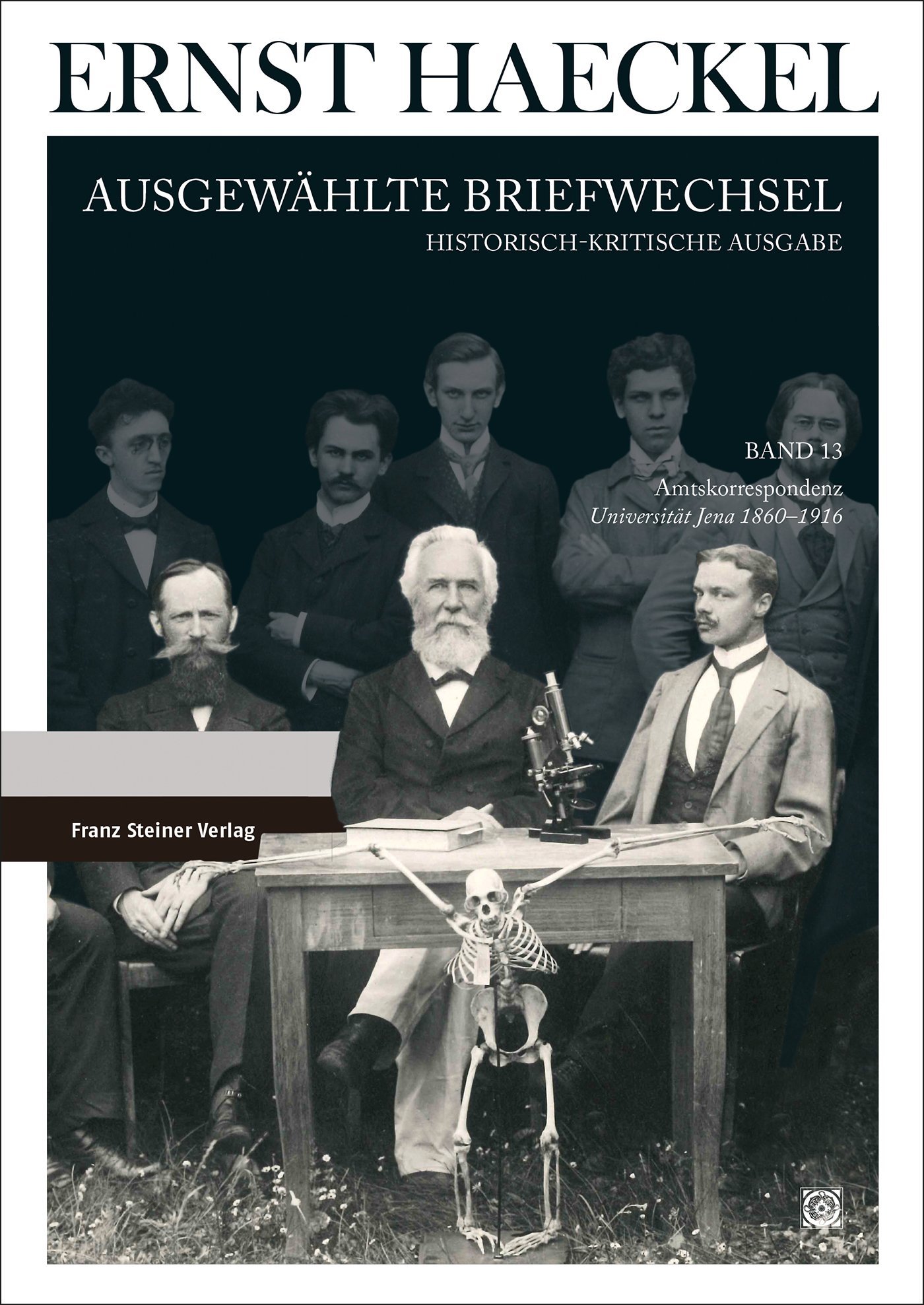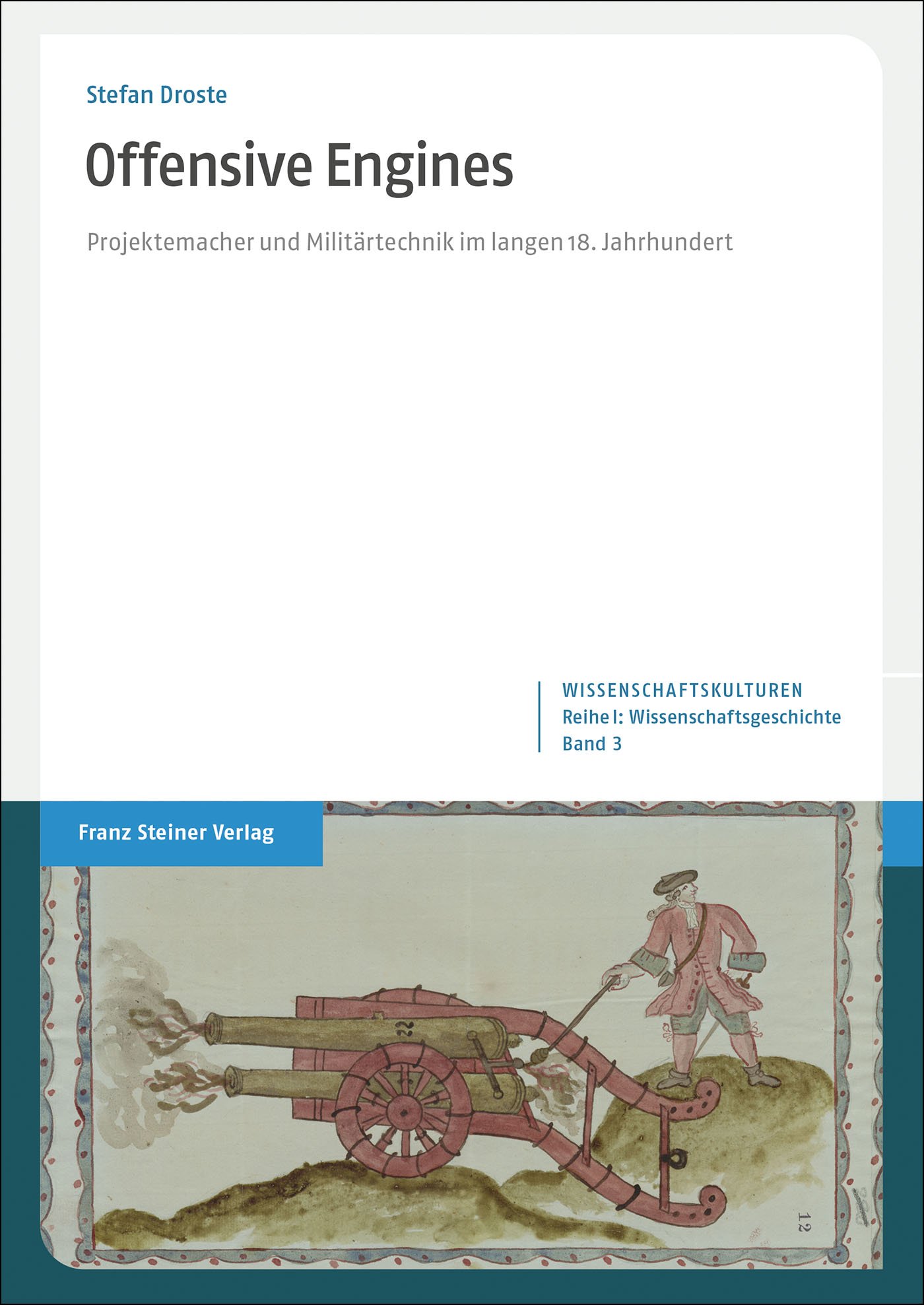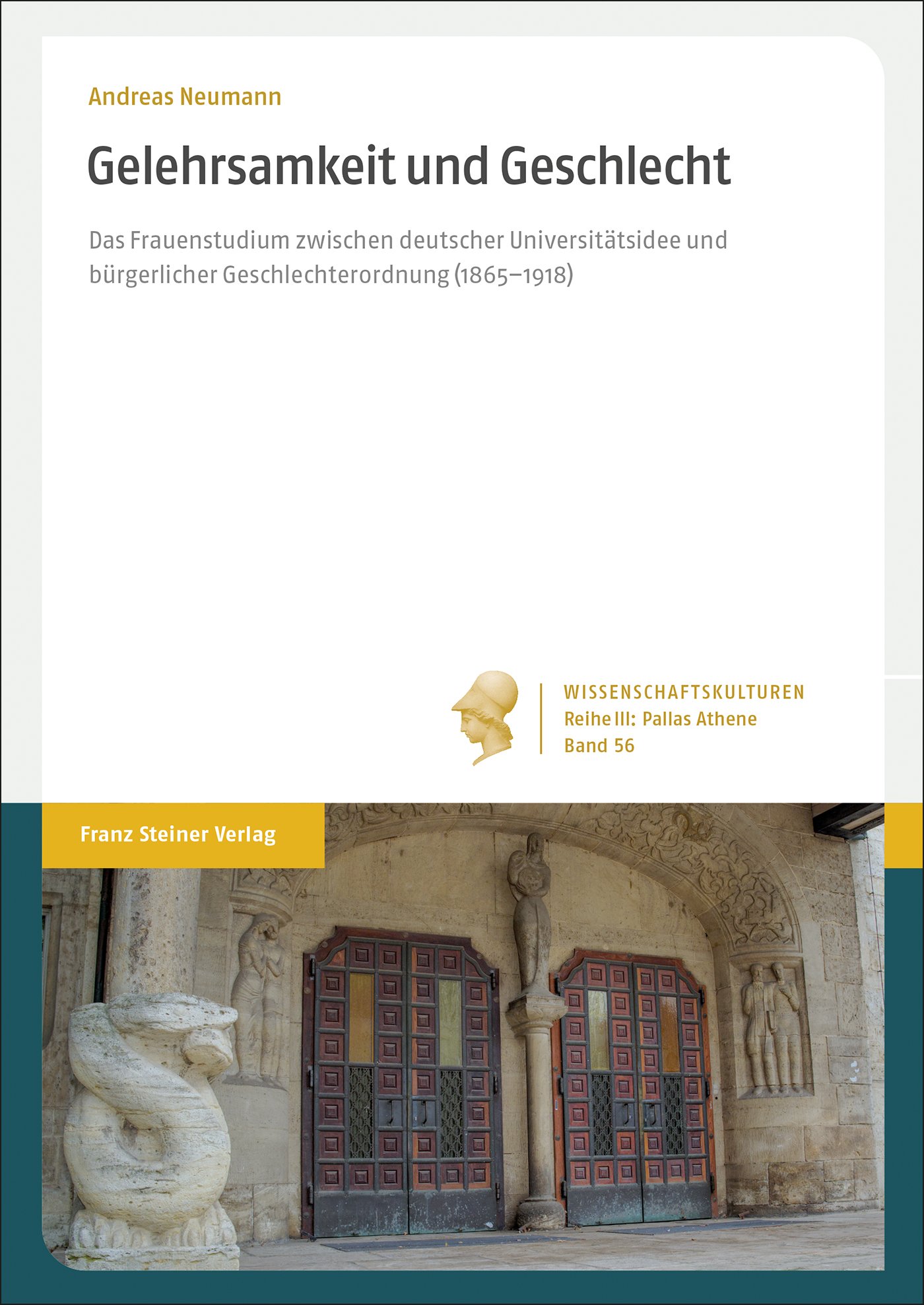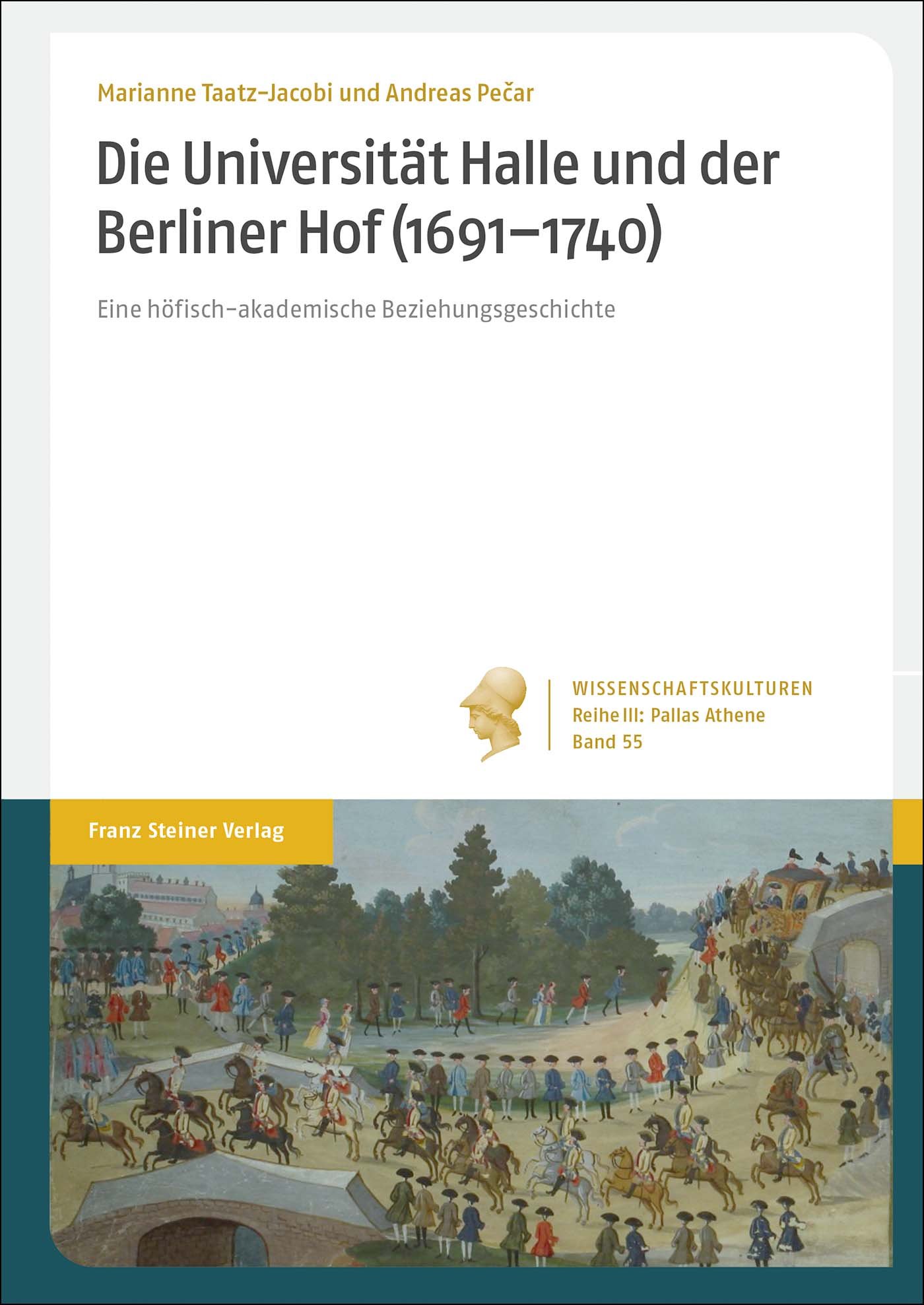Der sammelnde Professor
Der sammelnde Professor
Miriam Müller hat eine aufschlussreiche Arbeit über die Frühzeit der wissenschaftlichen Sammlungen an deutschen Universitäten vorgelegt und damit die Wissenschafts- und Universitätsgeschichte um wichtige Erkenntnisse bereichert.
Ole Fischer, Auskunft 41, 2021/1
Die Entstehung von Sammlungen ist eng mit dem Wandel des Wissenschaftsverständnisses im Europa der Frühen Neuzeit verknüpft: Neben das traditionelle Bücherwissen traten empirische Methoden, für die materielle Objekte und wissenschaftliche Instrumente zur Hauptquelle des Wissensgewinns, zu "Wissensdingen", wurden. Im 18. Jahrhundert entstanden in großem Umfang Professorensammlungen, mit denen neue Lehrmethoden Einzug in die Hörsäle unterschiedlichster Fächer hielten. Universitätseinrichtungen für die Arbeit mit Wissensdingen – botanische Gärten, chemische Labore, anatomische Theater – wurden erweitert und neu eingerichtet. Nicht zuletzt wurden die ersten institutionell an eine Universität angebundenen Sammlungen und Museen gegründet, die Wissensdinge zu einem festen Bestandteil der Hochschulen machten.
Die Praktiken, die diesem Wandlungsprozess zugrunde liegen, untersucht Miriam Müller an zahlreichen Beispielen. Eine breite Quellenbasis zu sammelnden Professoren an den Universitäten Göttingen, Halle (Saale), Helmstedt, Leipzig, Erlangen, Tübingen, Freiburg i. Br. und Ingolstadt ermöglicht dabei den vergleichenden Blick auf ein überregionales, fächerübergreifendes Phänomen, das die Wissenschaften bis heute prägt.
"Miriam Müllers Arbeit [...] kann jedem empfohlen werden, der sich mit Sammlungen und ihrer Historie, mit Wissensdingen und ihrer didaktischen Benutzung und mit dem spannungsreichen Leben an den Universitäten befasst."
Ingo Löppenberg, Lippische Mitteilungen 90, 2021
"Miriam Müller [liefert] einen wertvollen Einblick in die frühneuzeitliche Universitätspraxis."
Bernhard Homa, Zeitschrift für Historische Forschung 48, 2021/3
"Miriam Müller hat eine aufschlussreiche Arbeit über die Frühzeit der wissenschaftlichen Sammlungen an deutschen Universitäten vorgelegt und damit die Wissenschafts- und Universitätsgeschichte um wichtige Erkenntnisse bereichert."
Ole Fischer, Auskunft 41, 2021/1
| Reihe | Wissenschaftskulturen. Reihe I: Wissenschaftsgeschichte |
|---|---|
| Band | 1 |
| ISBN | 978-3-515-12714-1 |
| Medientyp | Buch - Gebunden |
| Auflage | 1. |
| Copyrightjahr | 2020 |
| Verlag | Franz Steiner Verlag |
| Umfang | 268 Seiten |
| Abbildungen | 8 s/w Abb. |
| Format | 17,0 x 24,0 cm |
| Sprache | Deutsch |