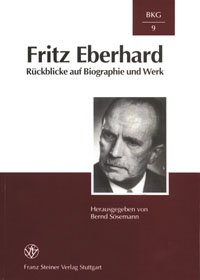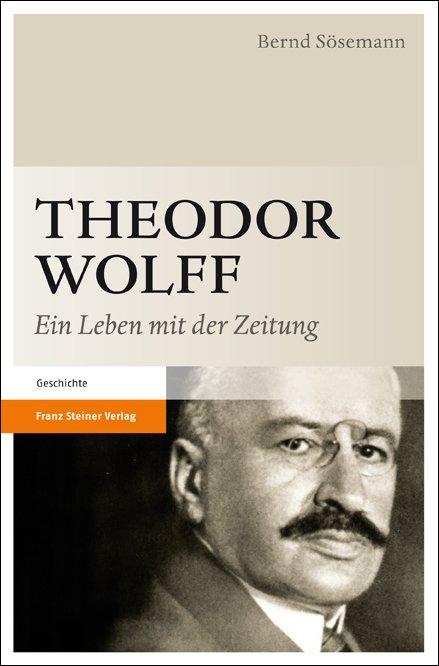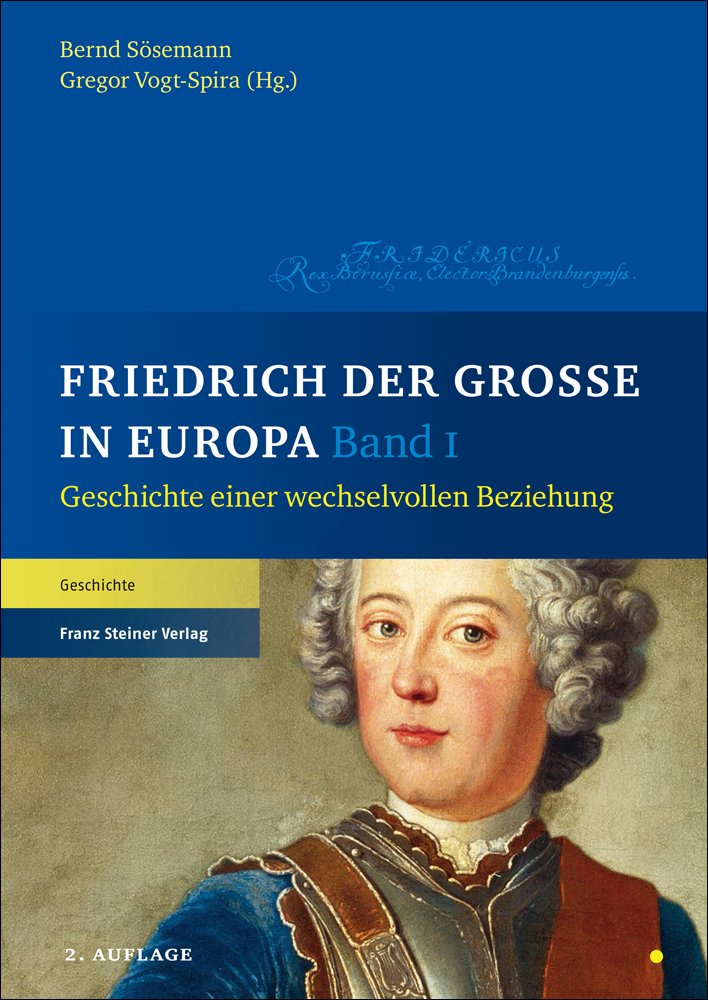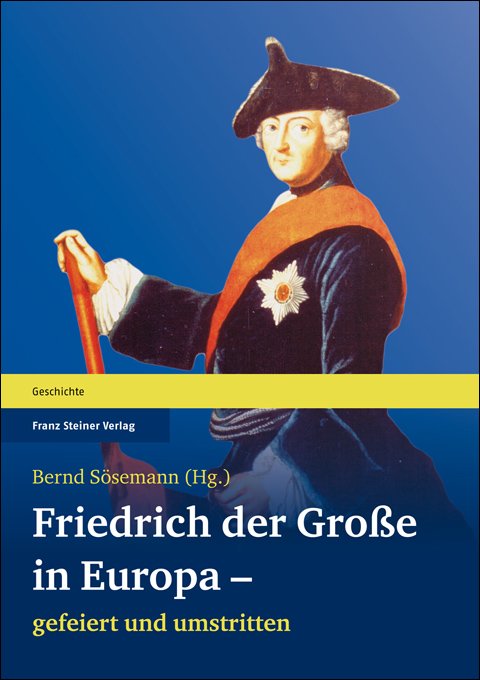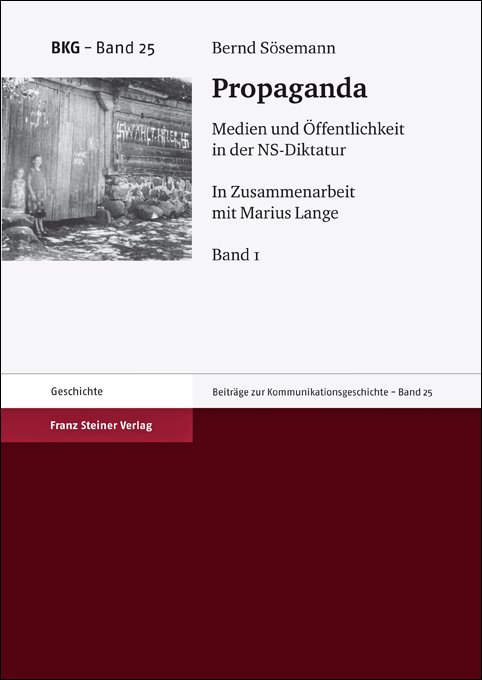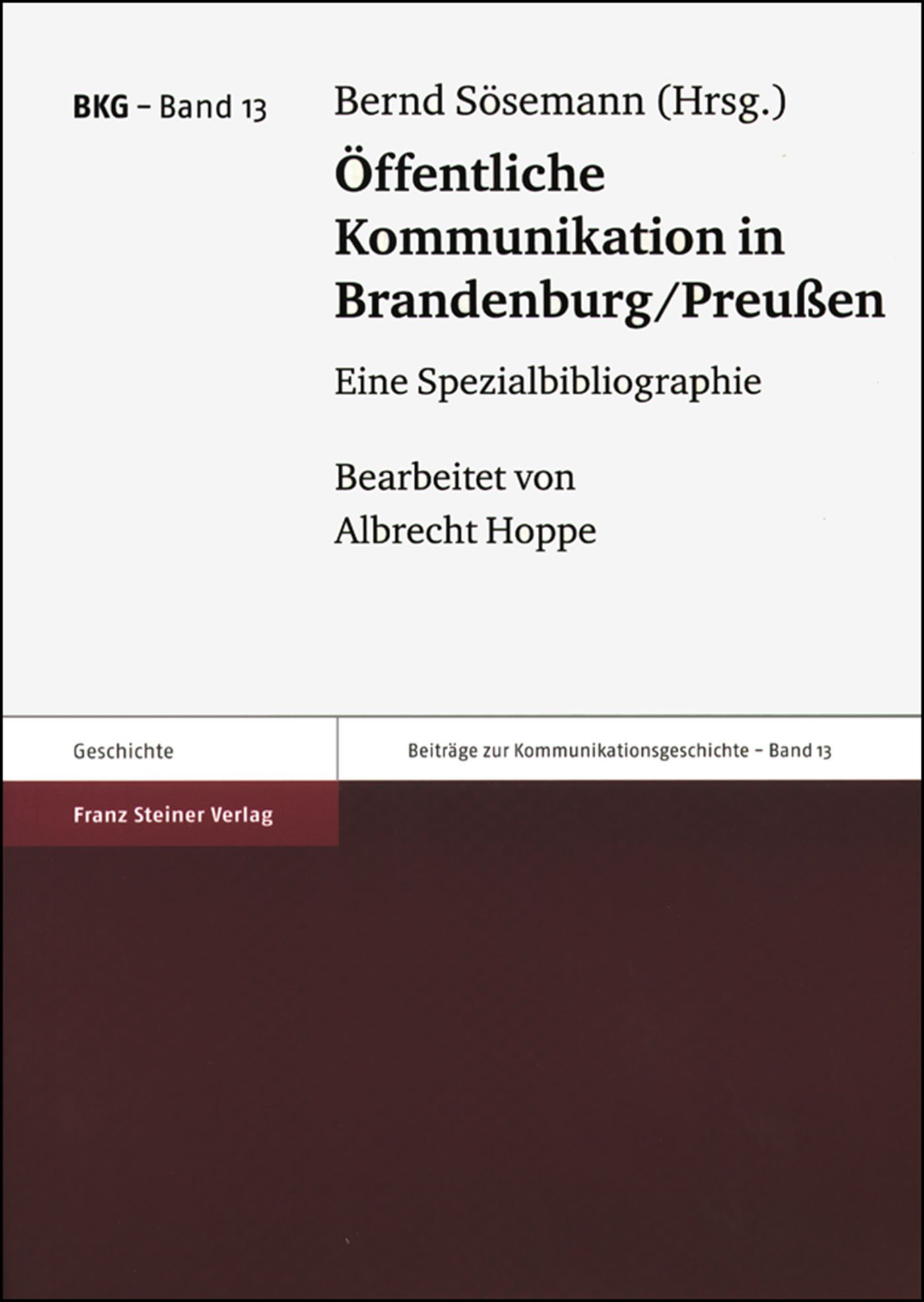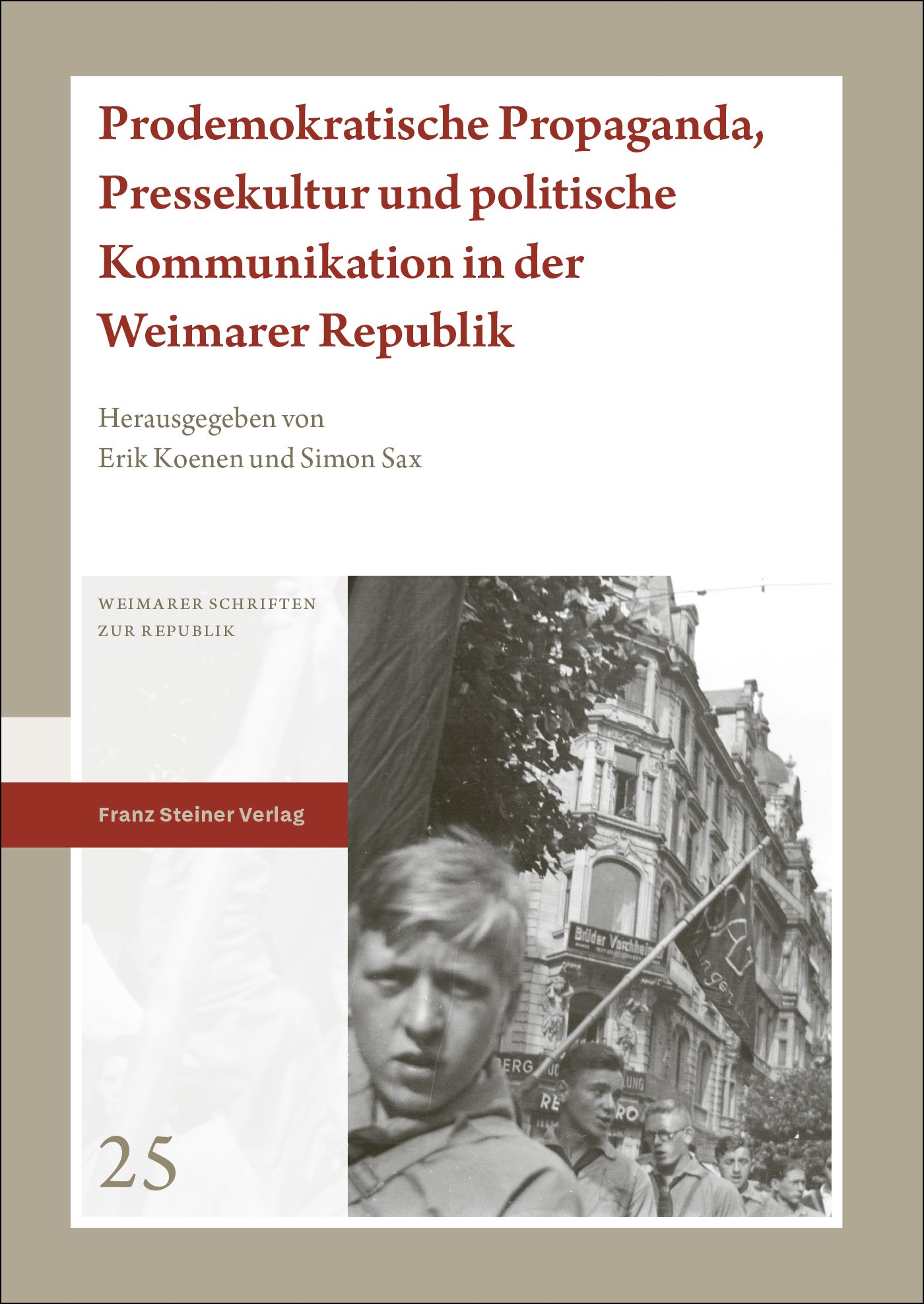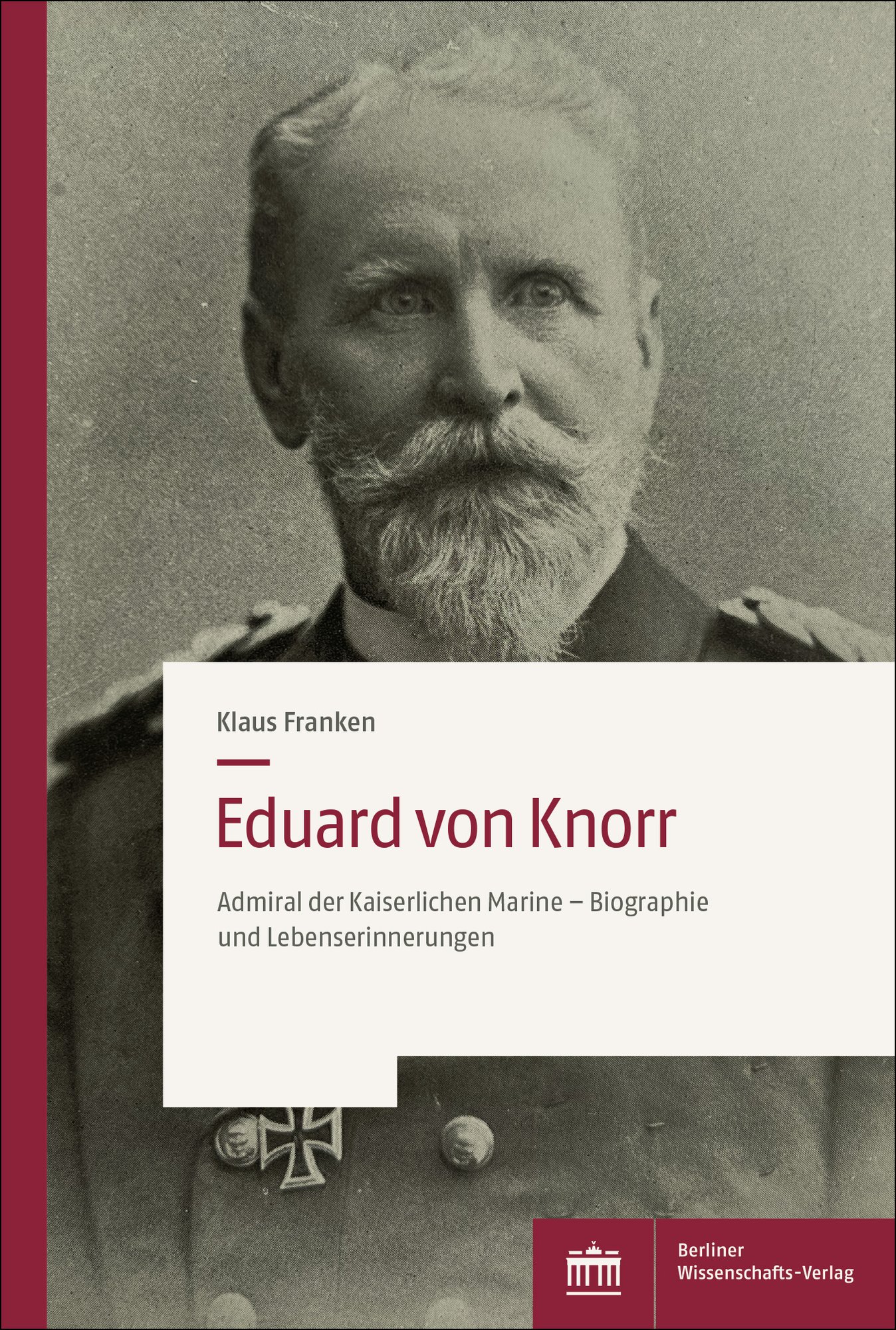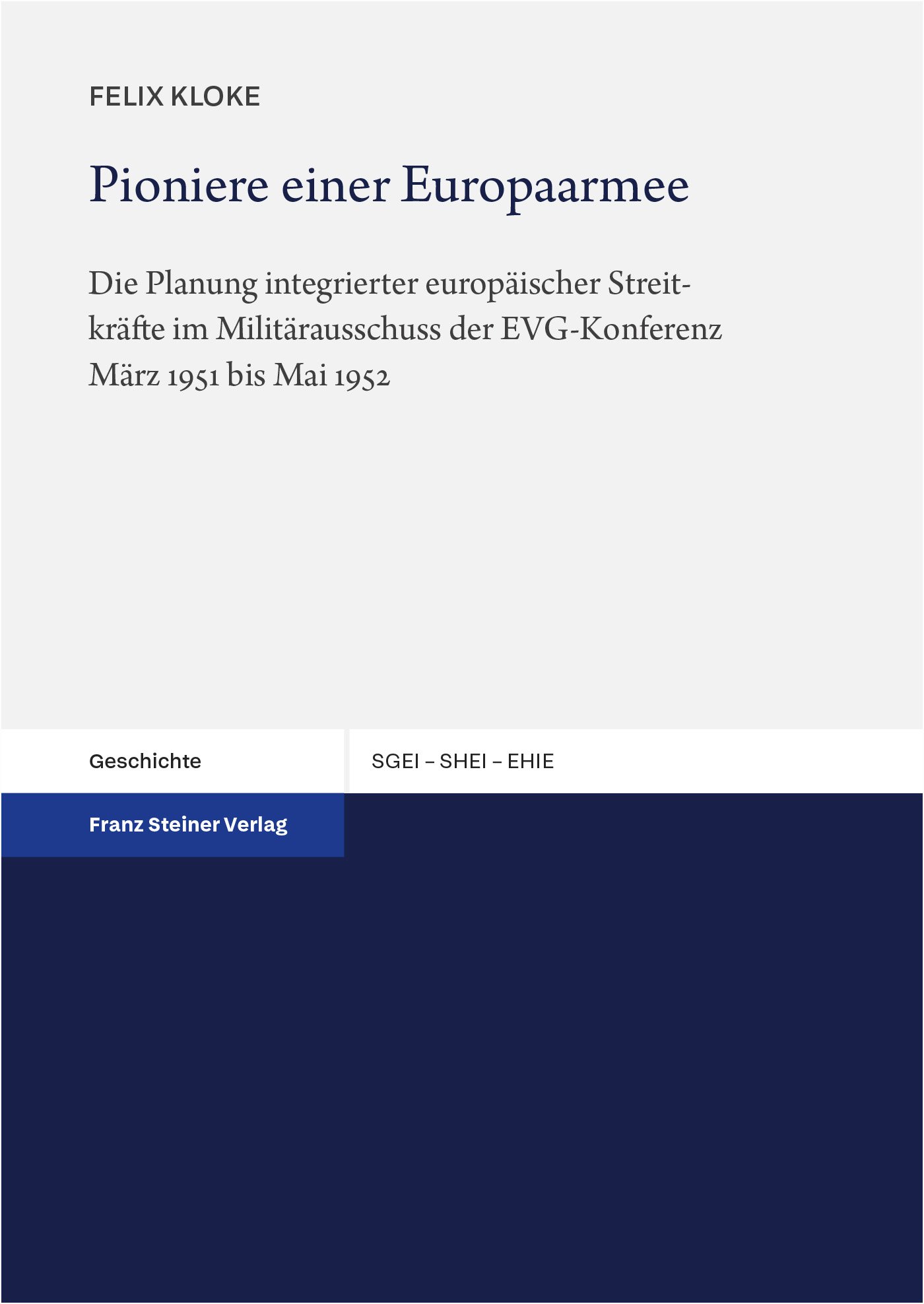Fritz Eberhard
Fritz Eberhard
Das Werk gliedert sich in drei Teile. Im ersten großen Abschnitt, den Darstellungen finden sich "Erinnerungen" von Susanne Miller, Dietrich Berwanger, Peter Glotz, Jan Tonnemacher, Andreas Wosnitza und Fritz Eberhard selbst sowie eine Chronik von Stefan Graf Finck von Finckenstein; im zweiten Teil schließen sich "Untersuchungen" an: H. B. Görtemaker: "Über den Luxus". Hellmuth von Rauschenplat und sein "Beitrag zur sozialökonomischen Theorie der produktiven Konsumption" — K. Koszyk: Hellmuth Rauschenplats Mitarbeit am "ISK" — W. Wippermann: Fritz Eberhard und der Internationale Sozialistische Kampf-Bund (ISK) — B. Sösemann: Journalistischer Kampf gegen den Nationalsozialismus im deutschen Untergrund und im französischen Exil — H. Haarmann: "Sozialist, Gewerkschaftler". Fritz Eberhard im Londoner Exil — I. Stuiber: Politik und Journalismus. Neuorientierung in Deutschland 1945-1949 — J. M. Schulz: "Bonn braucht sein Licht nicht unter den Scheffel zu stellen". Fritz Eberhards Arbeit im Parlamentarischen Rat — K. Dussel: Fritz Eberhard als Kommentator und Rundfunkintendant — H. Bohrmann: Fritz Eberhard als Förderer und Anreger der Kommunikationswissenschaft — P. Groos: Vision oder Zwangslage? Fritz Eberhards Positionierung in der akademischen Publizistik an der Freien Universität Berlin — S. Ruß-Mohl: Fritz Eberhard und Emil Dovifat.
Es folgen Wissenschaftliches und öffentliches Wirken in Dokumenten aus fünf Jahrzehnten. Der dritte Teil bietet erstmals eine Fritz Eberhard-Bibliographie, die die Untergrundspublizistik vollständig und die Exilpublizistik weitgehend erfaßt. In den übrigen Lebensabschnitten berücksichtigt sie auch Hörfunksendungen sowie Fernsehbeiträge und übertrifft damit ebenfalls alle bisherigen bibliographischen Zusammenstellungen bei weitem. Eine ausführliche Literaturliste zu allen Themen des Sammelbands, ein Autorenverzeichnis und ein Personenregister schließen den Band ab.
"Die faszinierende Persönlichkeit Fritz Eberhard wird in allen ihren Konturen mit seinen Ecken und Kanten sichtbar. Es ist das Verdienst des Herausgebers, alle publizierten Texte Eberhards ermittelt und in diesem Band wenigstens in Auswahl – mit Annotationen versehen – erneut veröffentlicht zu haben."
Rundfunk und Geschichte
"… der Band leistet beeindruckende Pionierarbeit und stellt ein unverzichtbares Instrument für jede weitere Forschung über diesen streitbaren Demokraten dar."
FAZ
"Endlich ist ein Werk erschienen, das hoffentlich eine breitere Eberhard-Rezeption einzuleiten vermag."
vorgänge
| Reihe | Beiträge zur Kommunikationsgeschichte |
|---|---|
| Band | 9 |
| ISBN | 978-3-515-07881-8 |
| Medientyp | Buch - Gebunden |
| Auflage | 1. |
| Copyrightjahr | 2001 |
| Verlag | Franz Steiner Verlag |
| Umfang | 517 Seiten |
| Abbildungen | 17 s/w Abb. |
| Format | 17,0 x 24,0 cm |
| Sprache | Deutsch |