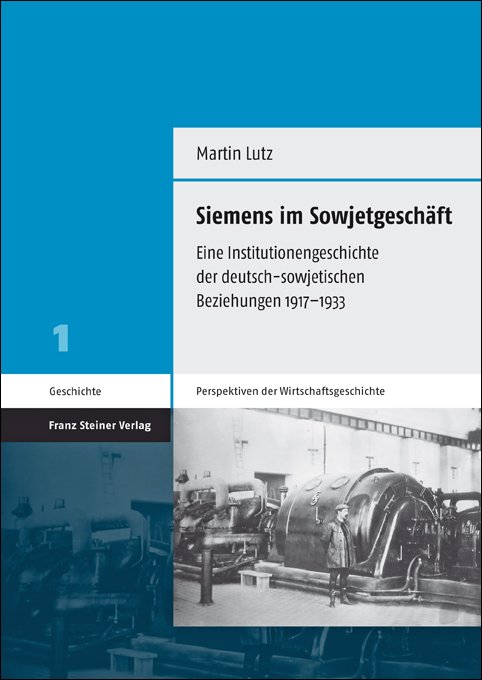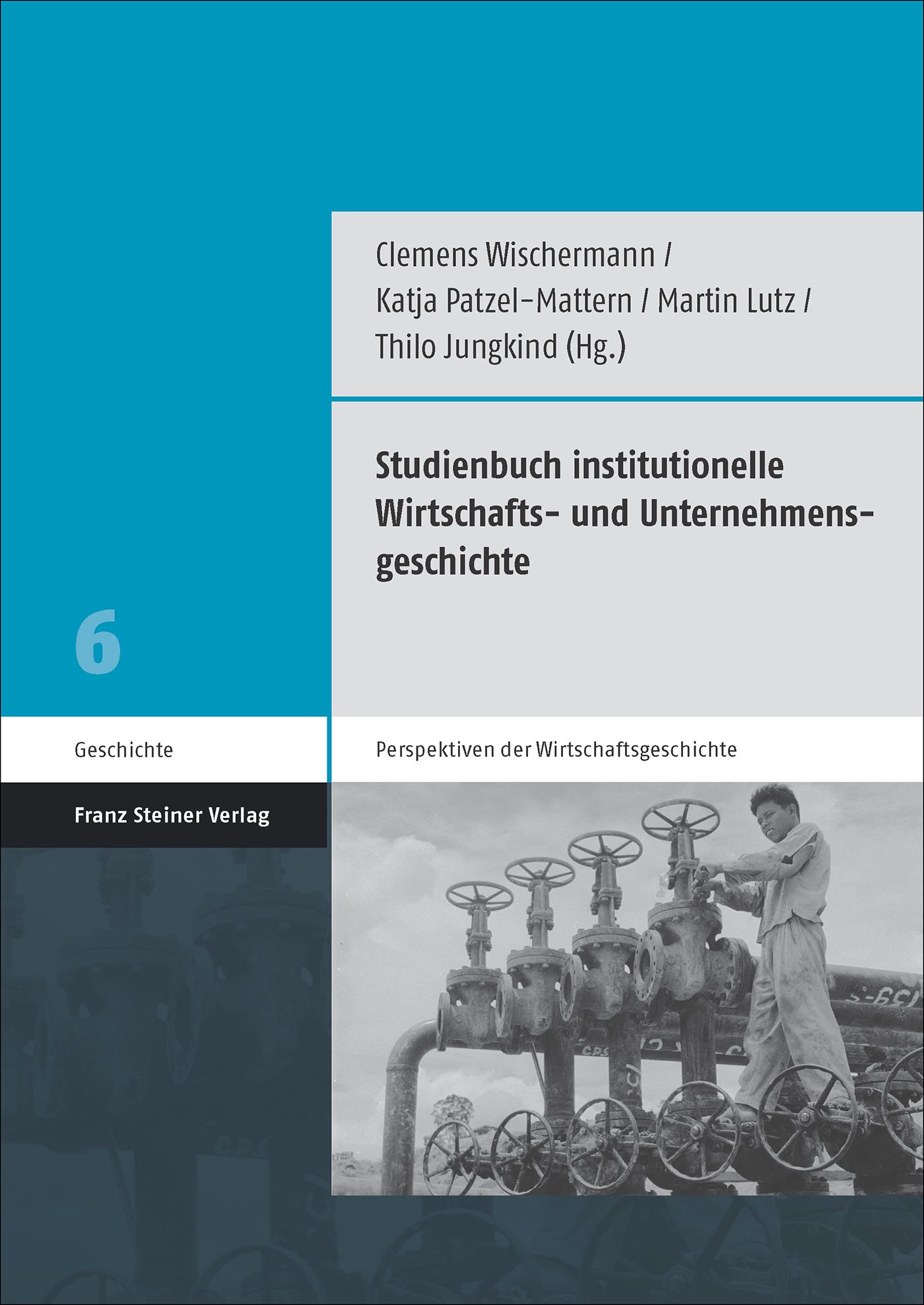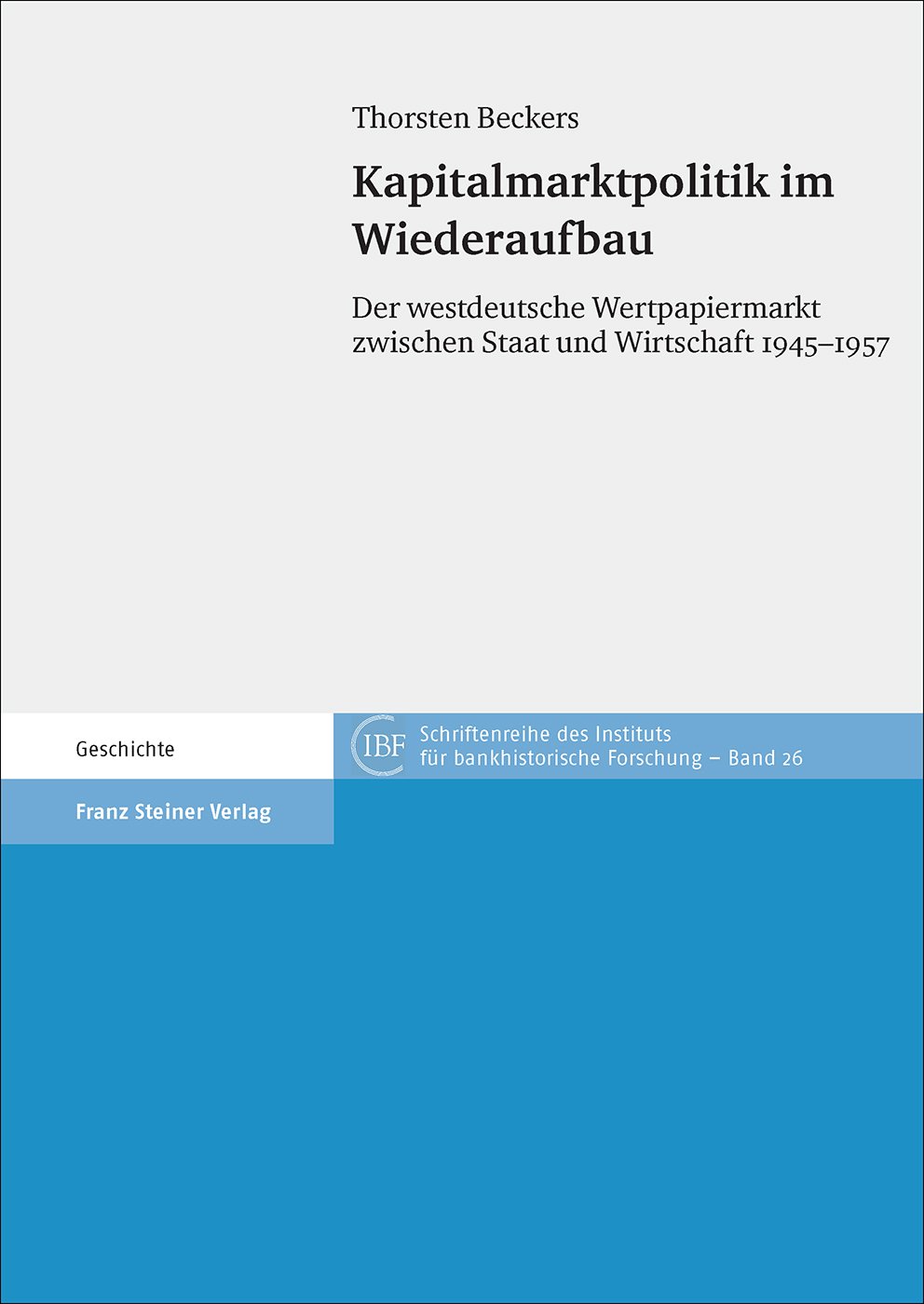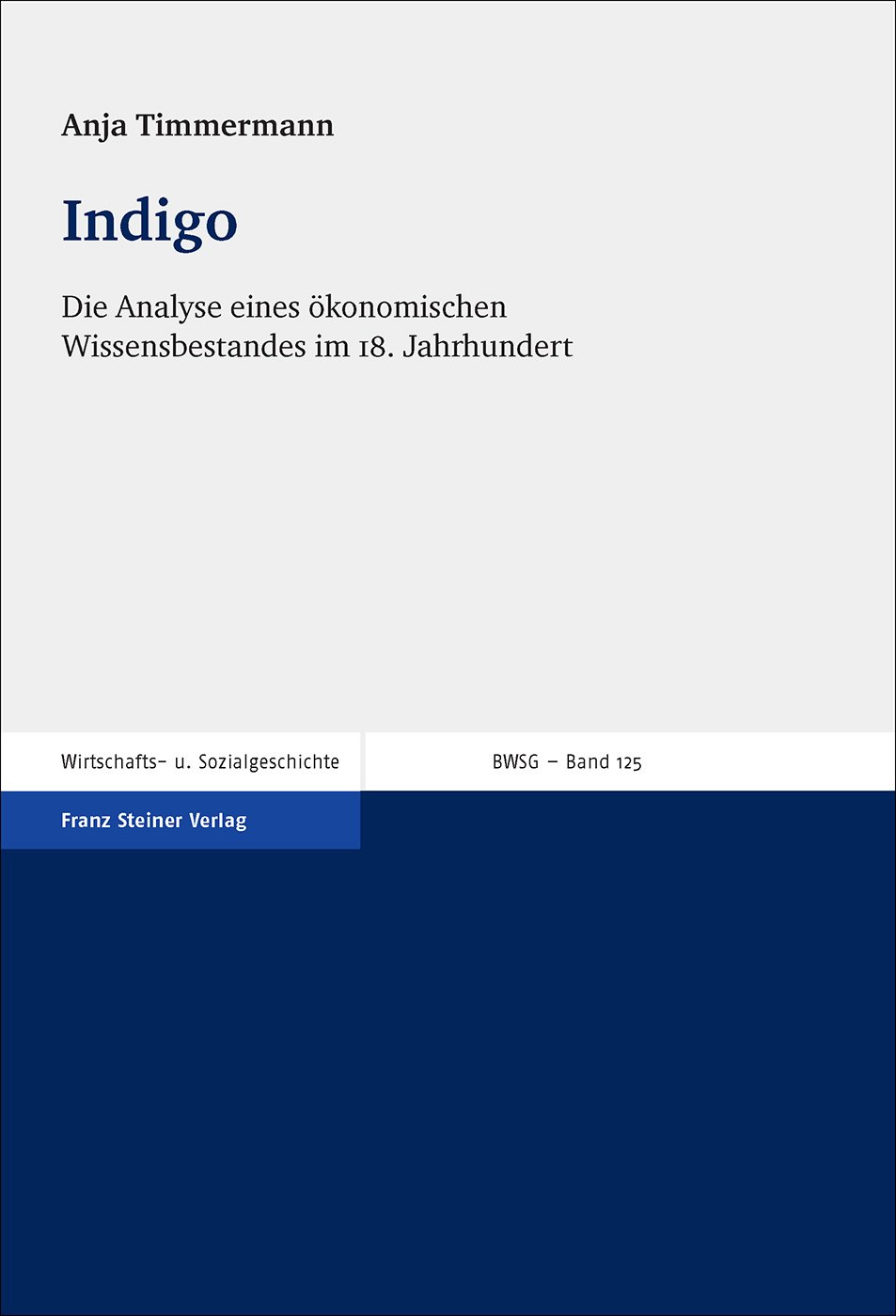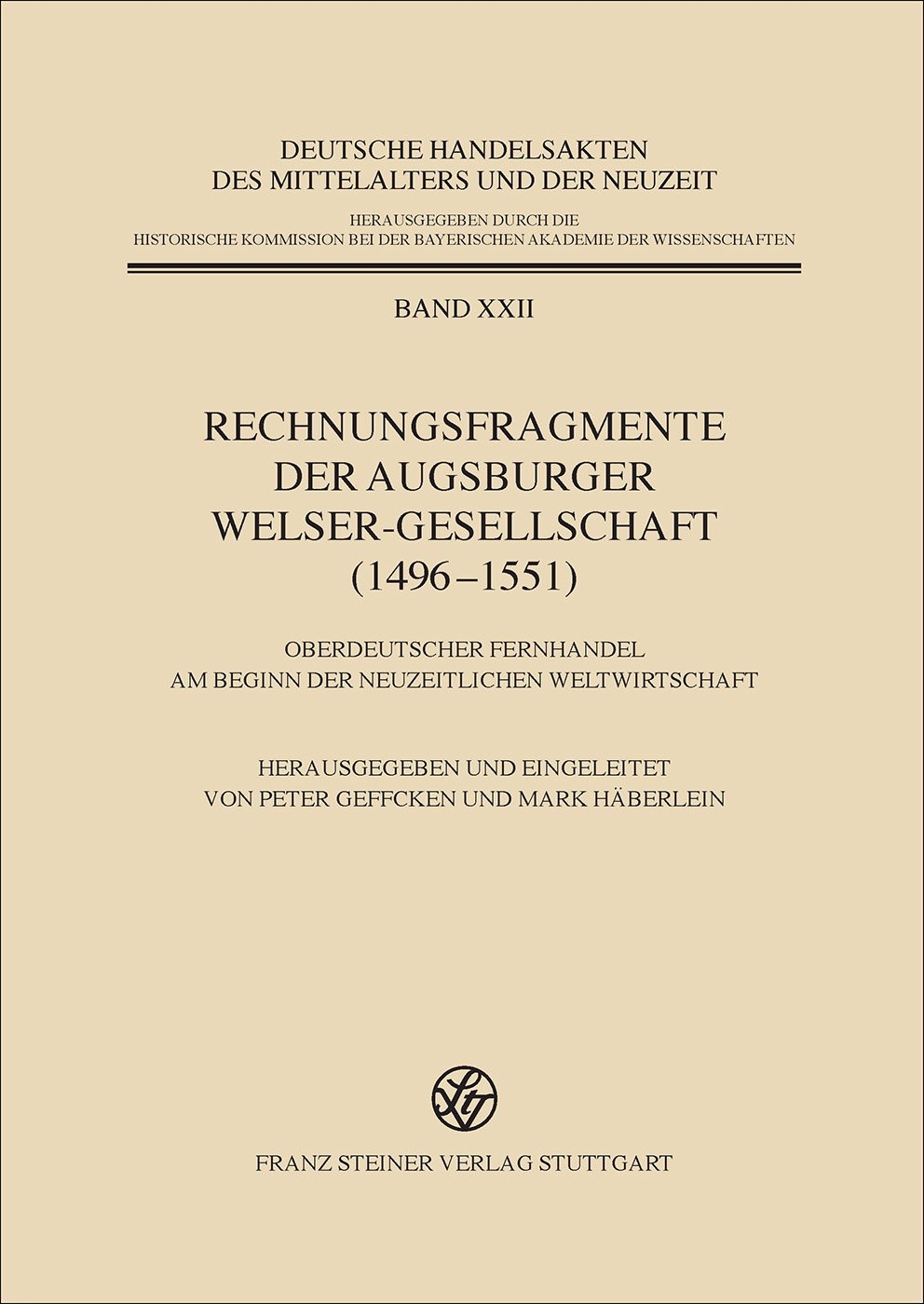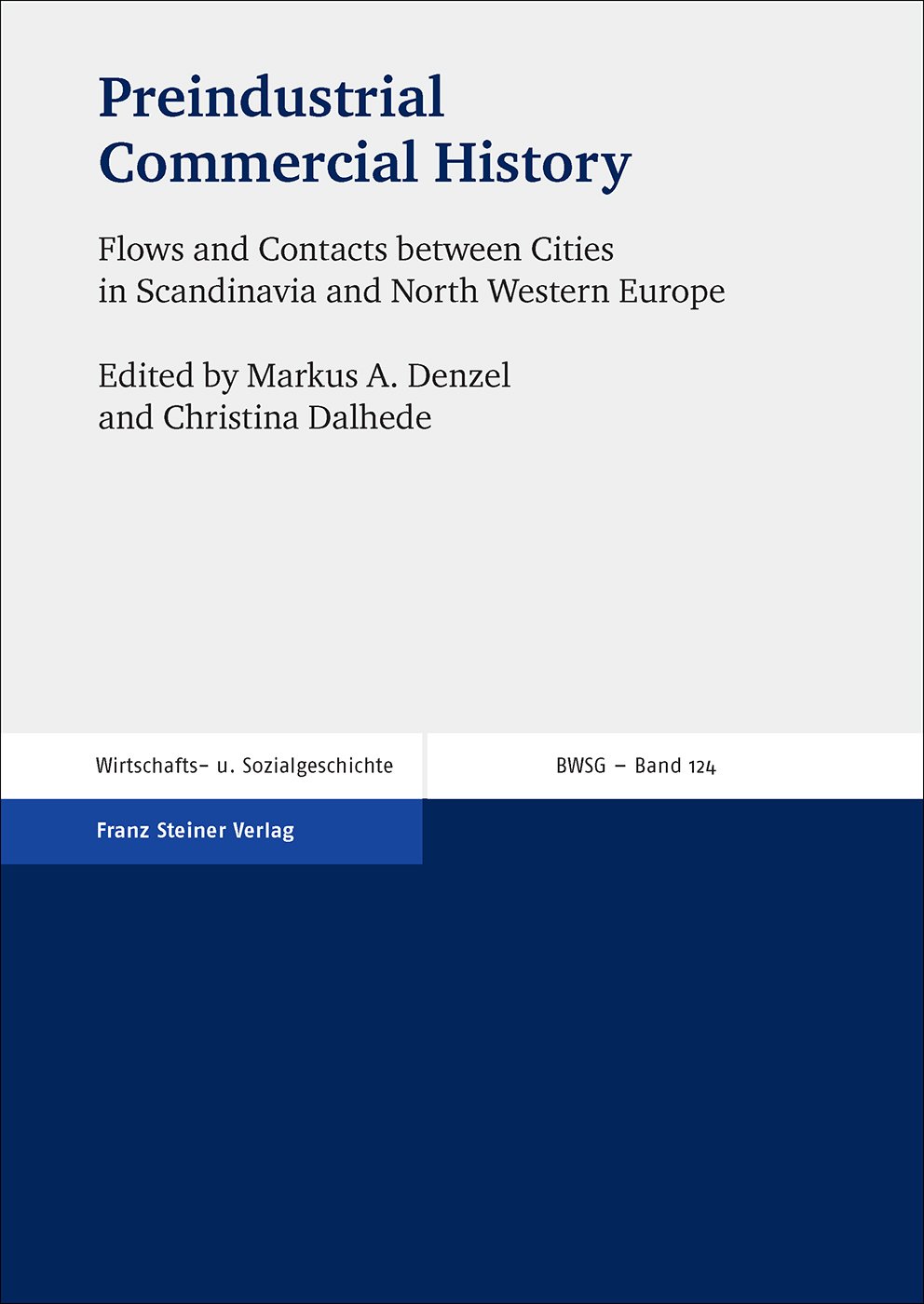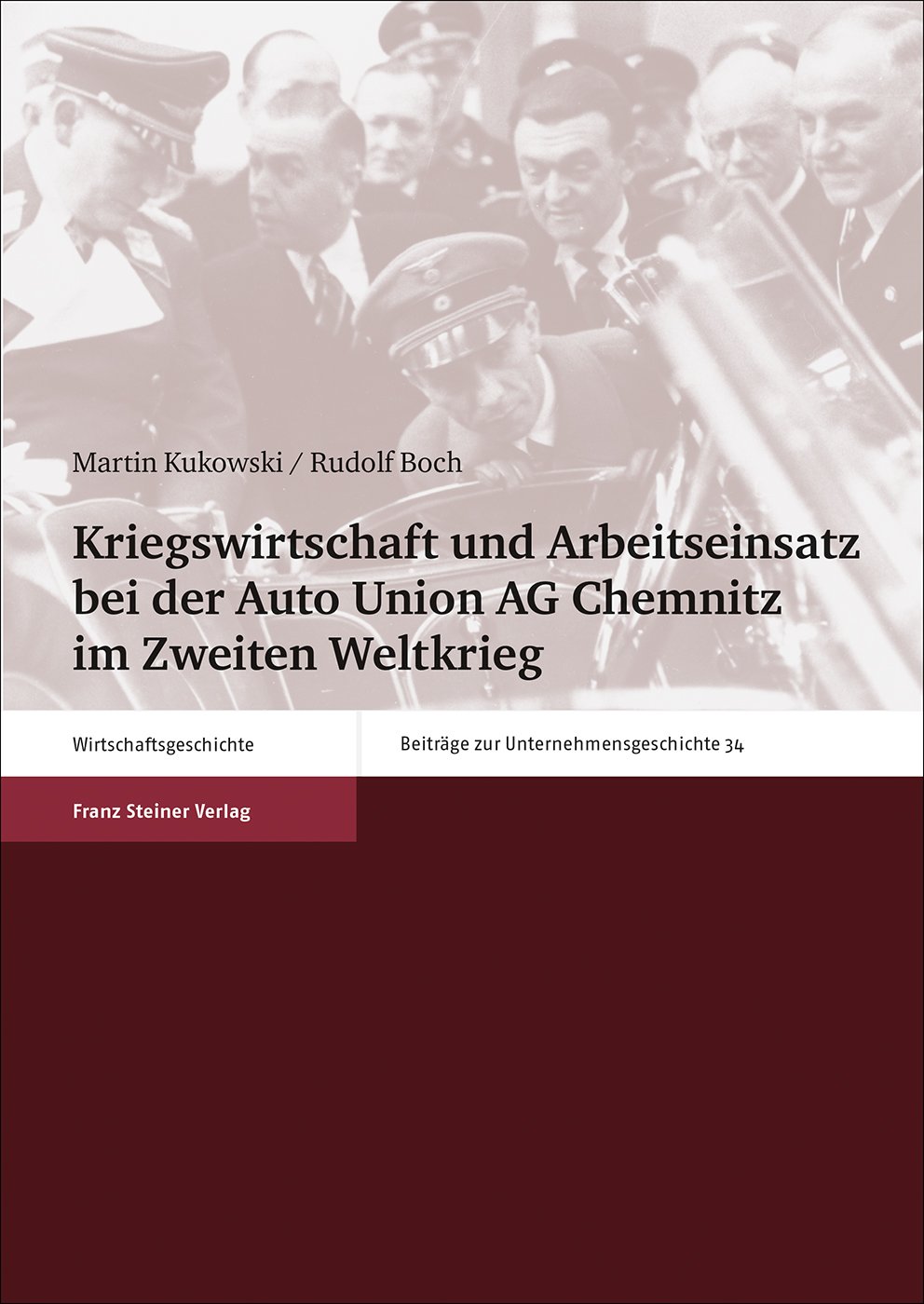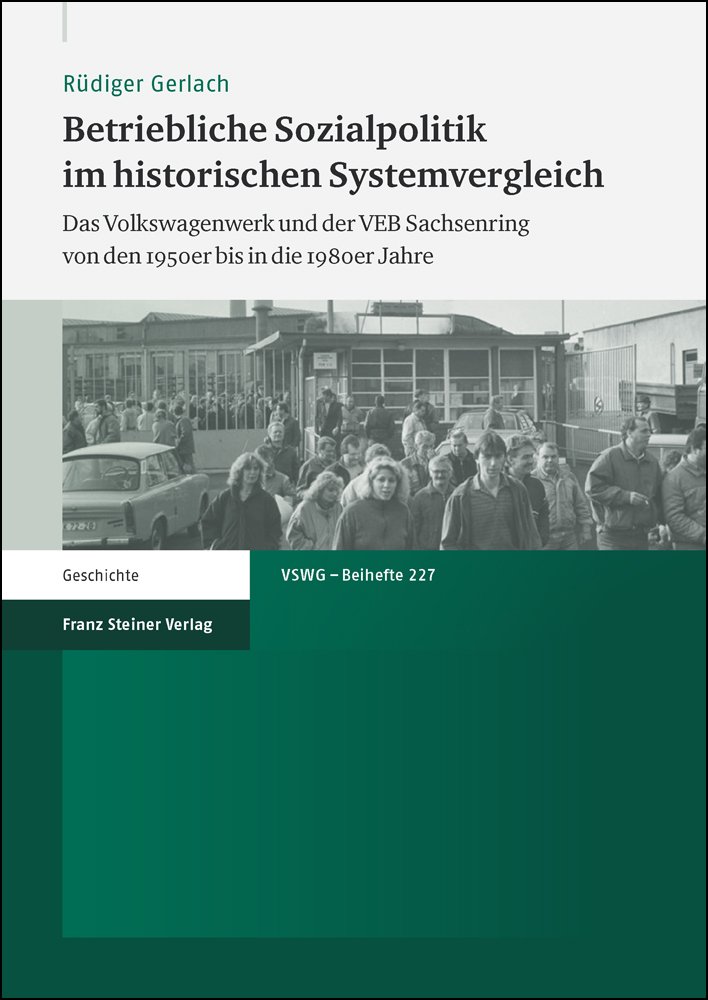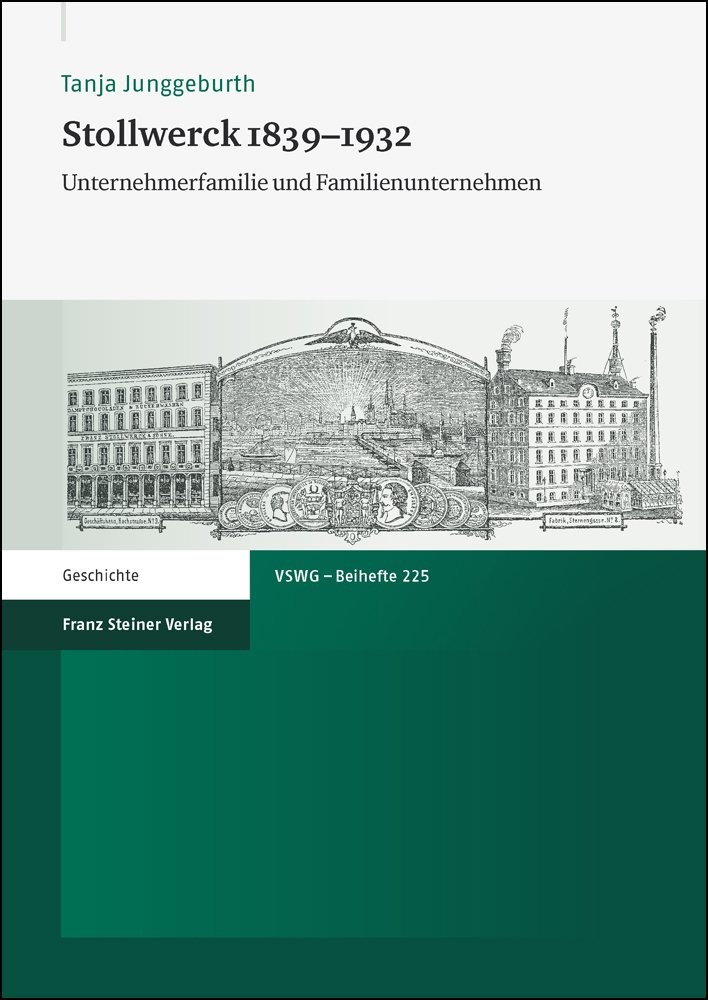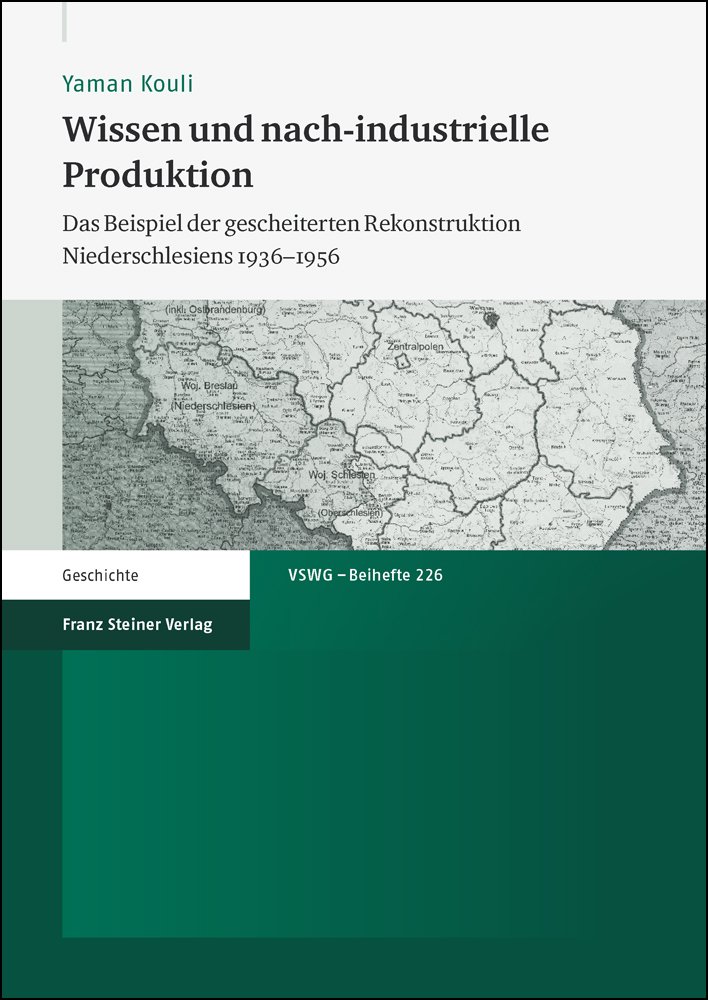Siemens im Sowjetgeschäft
Siemens im Sowjetgeschäft
"Kommunismus – das ist Sowjetmacht plus Elektrifizierung des ganzen Landes." Dieser Leitspruch Lenins war eine Grundlage dafür, dass nur wenige Jahre nach der Oktoberrevolution das kapitalistische Unternehmen Siemens Telefonanlagen, Generatoren, elektrische Motoren und zahlreiche weitere elektrotechnische Produkte an den sozialistischen Staat liefern konnte.
Anhand des Fallbeispiels Siemens untersucht Martin Lutz, welchen Stellenwert der Faktor Wirtschaft in den deutsch-sowjetischen Beziehungen zwischen 1917 und 1933 einnahm. Grundlage der Analyse ist ein erweiterter institutionentheoretischer Ansatz, der den Einfluss von Ideologie auf begrenzt rationale Akteure empirisch erfassbar macht. Das Ergebnis zeigt, dass die Wahrnehmung von Unsicherheit und Misstrauen das Sowjetgeschäft von Siemens maßgeblich beeinflussten.
"Wer sich mit Siemens und den deutsch-sowjetischen Wirtschaftsbeziehungen in der Weimarer Republik beschäftigt, sollte diese solide Untersuchung rezipieren."
Lutz Häfner, Historische Zeitschrift 295, 2012/3
"Lutz's study is clearly a pioneering, real case study. He demonstrates that many earlier studies on the German-Soviet trade relations in the interwar period have drawn unfounded generalizations, based on opinions in political circles or in business communities in general, but neglecting what prominent businessmen in particular companies thought."
Lennart Samuelson, The Russian Review 71, 2012/4
| Reihe | Perspektiven der Wirtschaftsgeschichte |
|---|---|
| Band | 1 |
| ISBN | 978-3-515-09802-1 |
| Medientyp | Buch - Gebunden |
| Auflage | 1. |
| Copyrightjahr | 2011 |
| Verlag | Franz Steiner Verlag |
| Umfang | 391 Seiten |
| Abbildungen | 16 s/w Abb., 8 s/w Tab., 7 s/w Zeichn. |
| Format | 17,0 x 24,0 cm |
| Sprache | Deutsch |