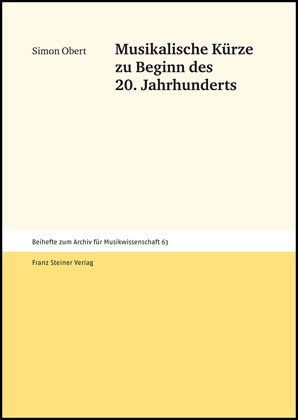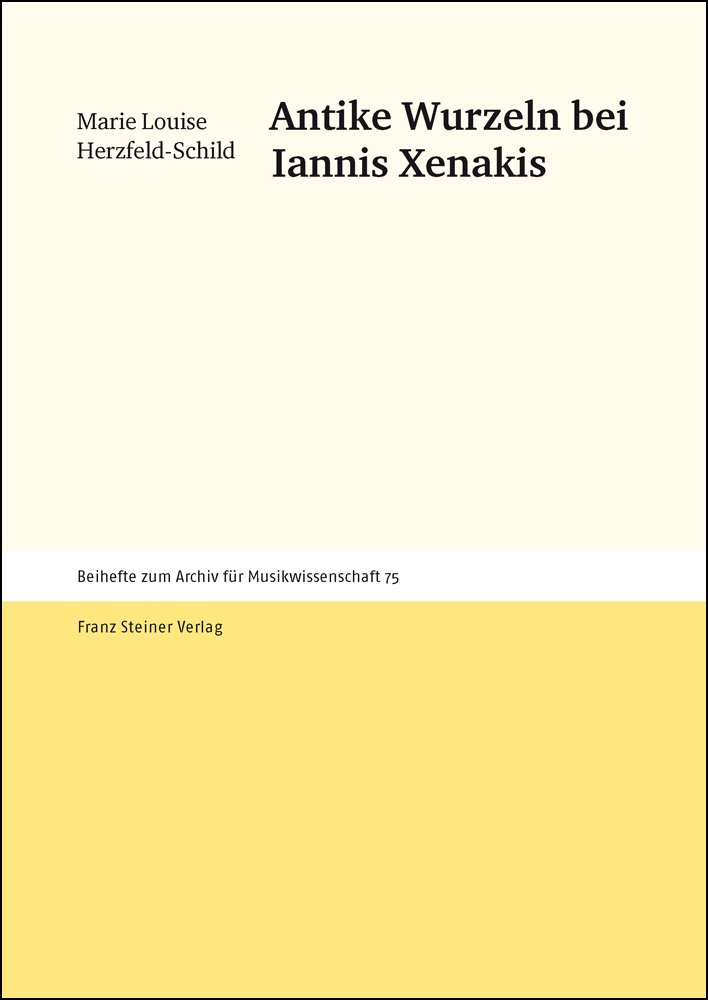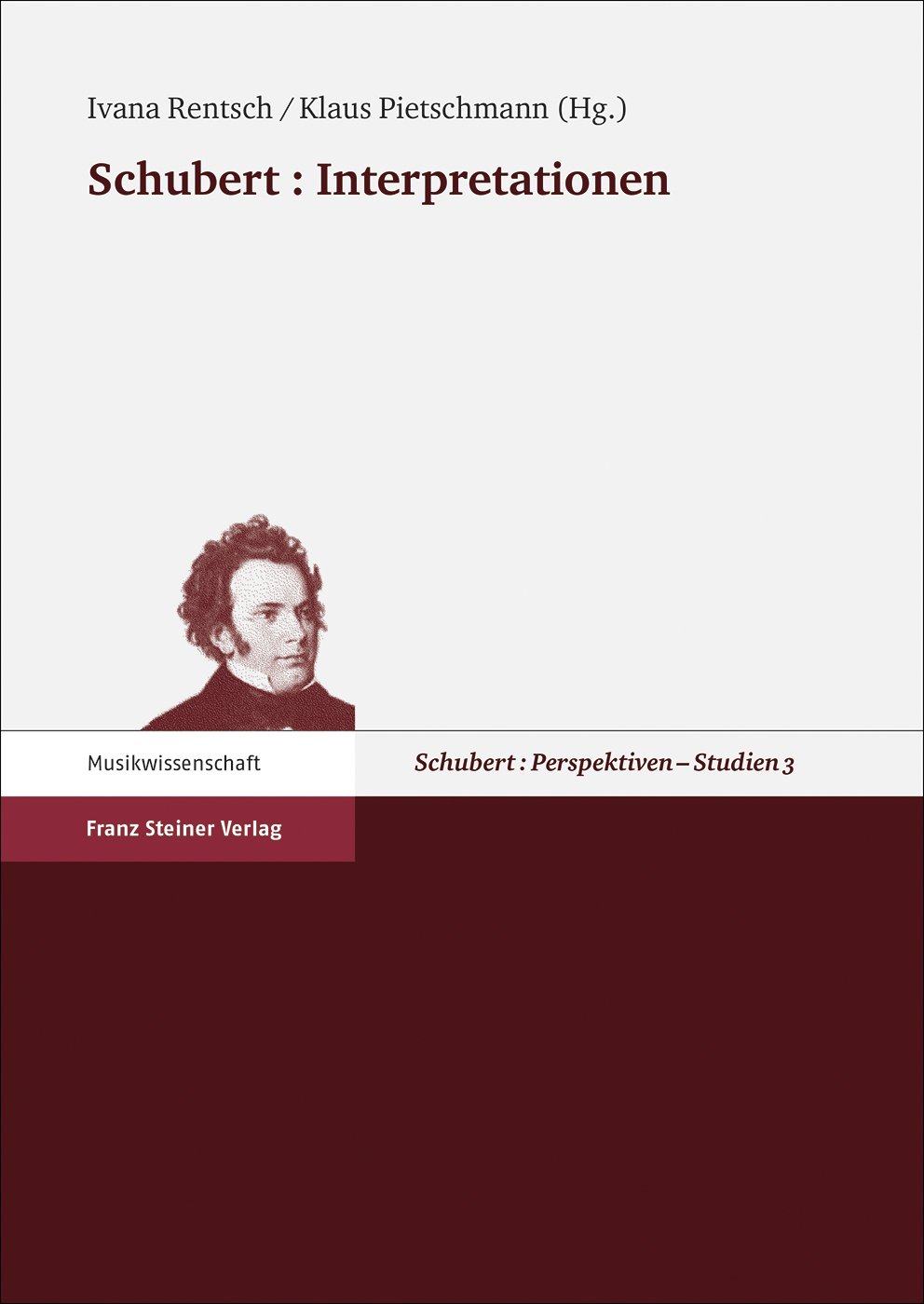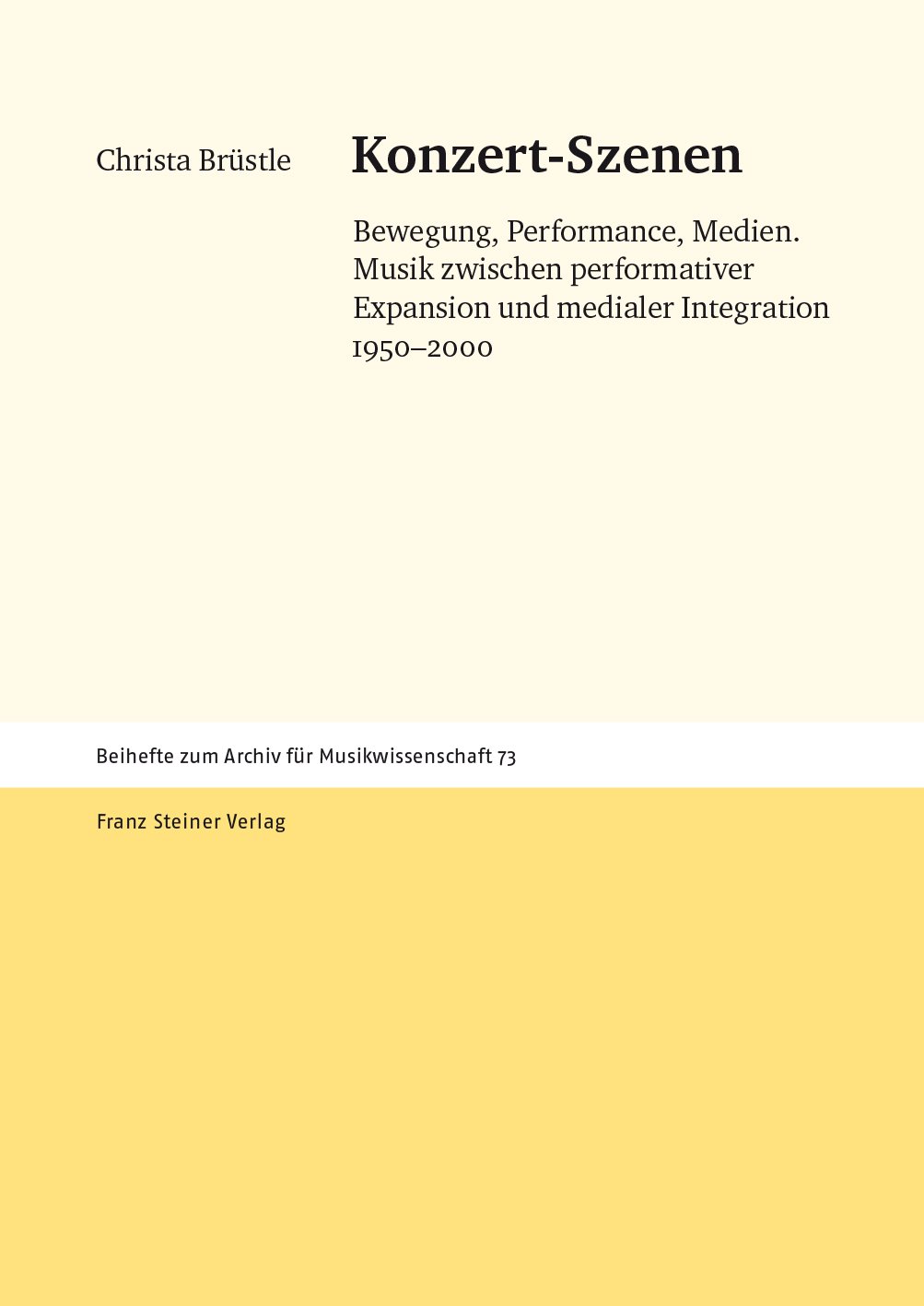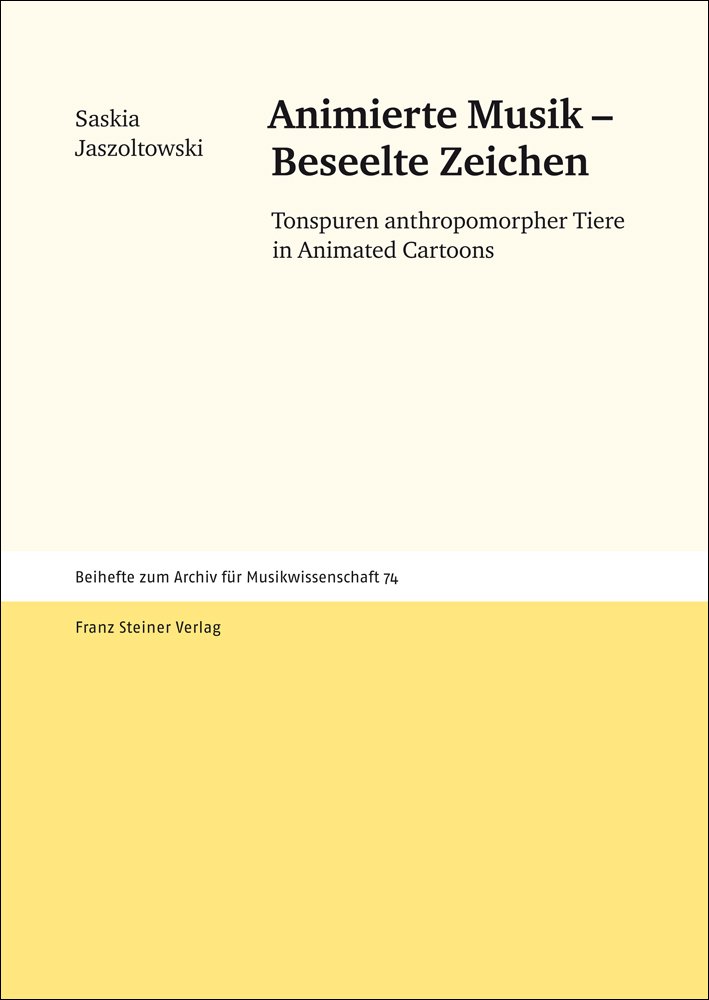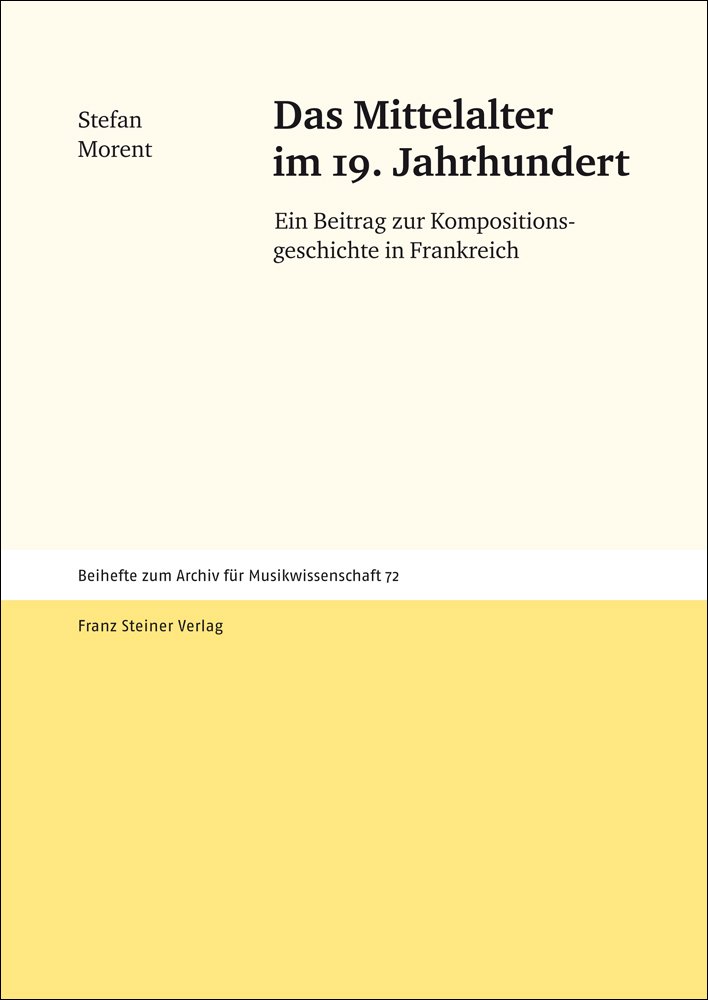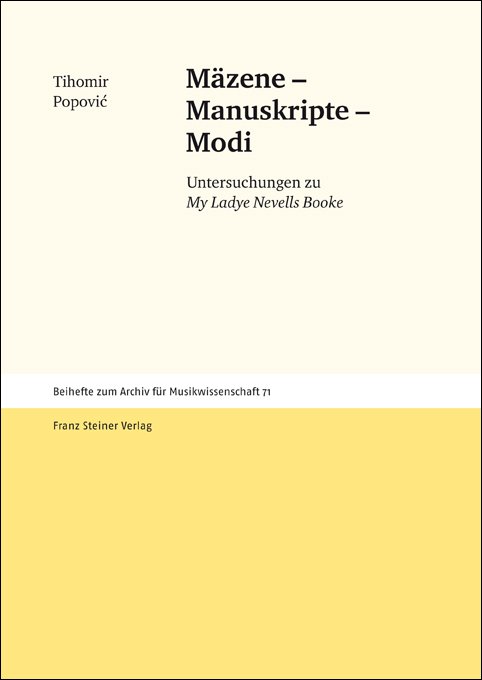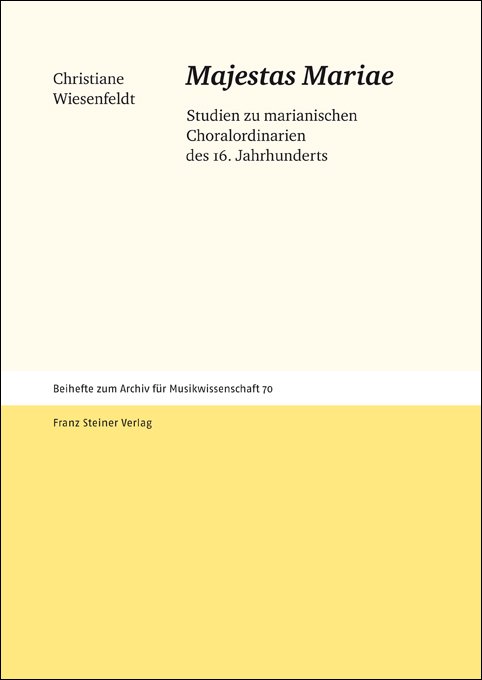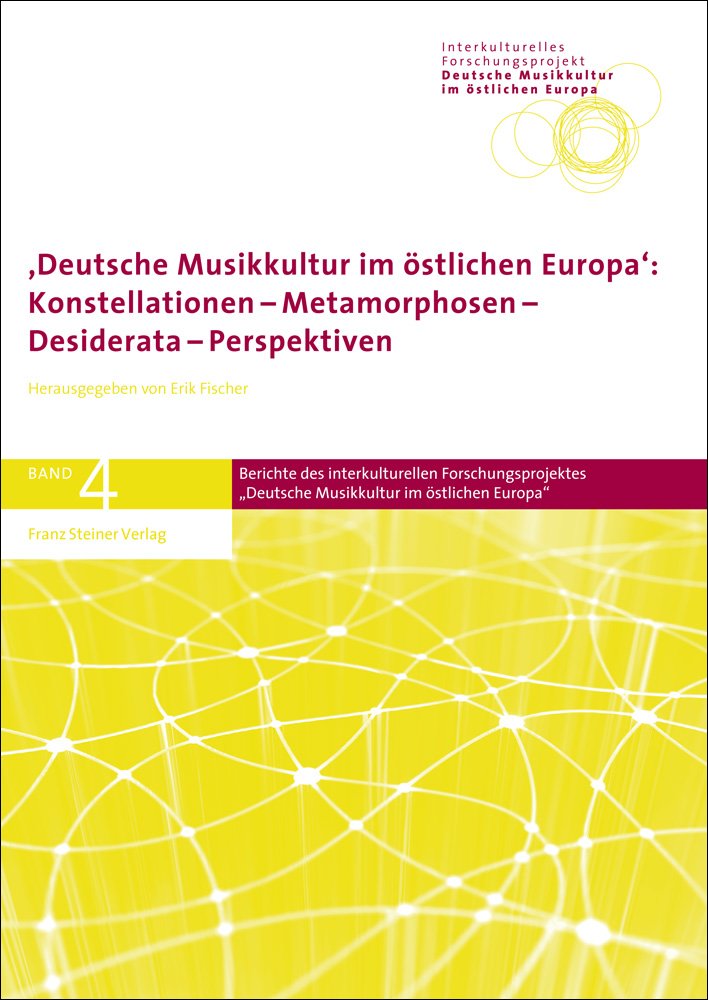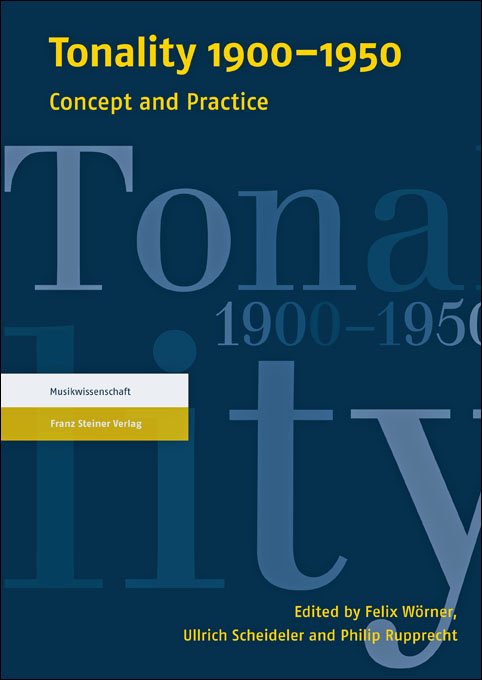Musikalische Kürze zu Beginn des 20. Jahrhunderts
Musikalische Kürze zu Beginn des 20. Jahrhunderts
Mit der Komposition extrem kurzer Stücke für größere Besetzungen erscheint in den Jahren um 1910 ein bis dahin unbekanntes Phänomen in der Musikgeschichte. Erstaunlicherweise wurde es von so unterschiedlichen Komponisten wie Charles Ives, Erik Satie, Arnold Schönberg, Igor Strawinsky und Anton Webern teilweise unabhängig voneinander verwirklicht.
Ausgehend von diesen Beobachtungen beleuchtet der Band das bisher kaum beachtete Phänomen der musikalischen Kürze in seinen theoretischen, kulturhistorischen, kompositorischen und ästhetischen Dimensionen. Doch Kürze ist nicht gleich Kürze. Sie kann einer klaren Fasslichkeit ebenso dienen, wie sie sich hermetisch dem Hörer entzieht, als Mangel ebenso abgelehnt, wie als ästhetisches Ideal befürwortet werden. Das Ausloten solcher Wechselverhältnisse macht nicht nur auf einen wichtigen Aspekt der Moderne aufmerksam. Vermittelt werden zudem jene Irritation und Faszination, die musikalische Kürze um 1910 kennzeichneten und die sie bis heute auszustrahlen vermag.
Ausgehend von diesen Beobachtungen beleuchtet der Band das bisher kaum beachtete Phänomen der musikalischen Kürze in seinen theoretischen, kulturhistorischen, kompositorischen und ästhetischen Dimensionen. Doch Kürze ist nicht gleich Kürze. Sie kann einer klaren Fasslichkeit ebenso dienen, wie sie sich hermetisch dem Hörer entzieht, als Mangel ebenso abgelehnt, wie als ästhetisches Ideal befürwortet werden. Das Ausloten solcher Wechselverhältnisse macht nicht nur auf einen wichtigen Aspekt der Moderne aufmerksam. Vermittelt werden zudem jene Irritation und Faszination, die musikalische Kürze um 1910 kennzeichneten und die sie bis heute auszustrahlen vermag.
"[… ein] sehr lesenswertes Buch […]."
Die Tonkunst 3, 2008/2
| Reihe | Archiv für Musikwissenschaft – Beihefte |
|---|---|
| Band | 63 |
| ISBN | 978-3-515-09153-4 |
| Medientyp | Buch - Gebunden |
| Auflage | 1. |
| Copyrightjahr | 2008 |
| Verlag | Franz Steiner Verlag |
| Umfang | 307 Seiten |
| Abbildungen | 1 s/w Abb., 37 Notenbeisp. |
| Format | 17,0 x 24,0 cm |
| Sprache | Deutsch |